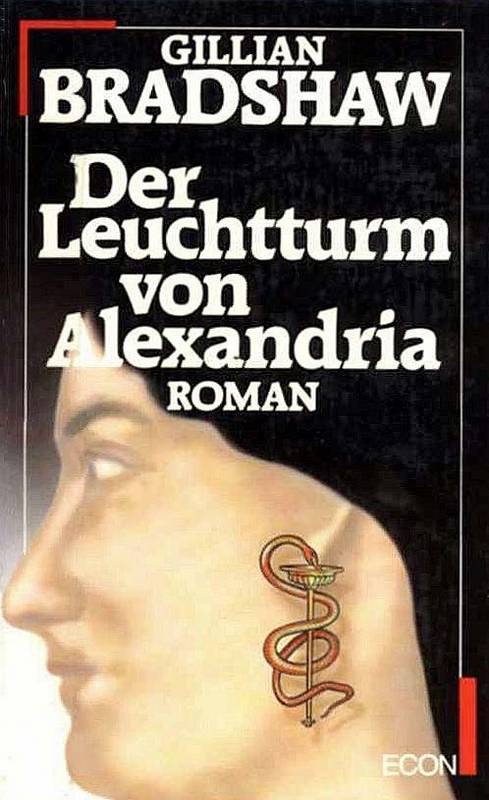![Der Leuchtturm von Alexandria]()
Der Leuchtturm von Alexandria
ihn geschickt, doch es wurde nicht darüber gesprochen. Ich tat mein Bestes, um mich für die zwei zu freuen, und manchmal gelang es mir sogar. Aber ich war längst nicht mehr so glücklich wie zuvor.
In dem darauffolgenden Frühjahr wurde ich neunzehn. Ich verbrachte den Tag damit, einen Patienten zu betreuen, der an Fleckfieber erkrankt war. Der Mann war Stellmacher; er war verheiratet und hatte drei junge Kinder; seine Frau geriet in Panik, als sie an jenem Morgen bemerkte, daß sein Fieber stieg. Sie bat mich, den Tag über dort zu bleiben. Ich blieb, und es gelang mir, das Fieber zu senken, indem ich den Körper des Kranken mit einer Essiglösung abrieb und ihm mit Hilfe von Fingerkraut und Opium zu ein wenig Schlaf verhalf. Dann sorgte ich dafür, daß er etwas Brühe trank und sie auch bei sich behalten konnte. Als ich ging, schlief er so friedlich wie schon lange nicht mehr, das Fieber schien nicht mehr so hoch zu sein, und der Puls war ganz eindeutig kräftiger und gleichmäßiger als seit Tagen. Seine Frau ergriff meine Hand und drückte sie fest. Ihre Augen waren voller Tränen. »Wird er wieder gesund?« fragte sie mich.
»Ich glaube schon«, erwiderte ich. »Laß ihn solange wie möglich schlafen. Wenn er Durst hat, gib ihm etwas Honigwasser. Morgen früh kann er ein wenig klare Brühe bekommen, aber nur, wenn er möchte. Am Vormittag komme ich dann noch einmal. Falls sich sein Zustand während der Nacht verschlimmern sollte, ruf mich.«
Sie nickte. »Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen, wenn er stirbt«, meinte sie.
»Falls er keinen Rückfall erleidet, wird er wahrscheinlich durchkommen«, entgegnete ich, nachdem ich ihr Verlangen, beruhigt zu werden, gegen die Gefahr abgewogen hatte, falsche Hoffnungen zu wecken. Aber eigentlich war ich sicher, daß er es schaffen würde: Er war stark, und das Schlimmste war vorüber.
Die Frau brach in Tränen aus und drückte mir wieder und wieder die Hand.
»Ich danke dir! Gott möge dich belohnen!«
»Geh und schlaf, solange es möglich ist«, riet ich ihr und machte mich auf den Heimweg.
Als ich zu Hause ankam, fand ich die Familie beim Abendessen vor.
Theogenes war ebenfalls dort. Er saß neben Theophila, beugte sich zu ihr hinüber und lächelte. Sie lächelte mit niedergeschlagenen Augen zurück.
Wunderbar, dachte ich bei mir und war glücklich.
»Wie geht es dem Patienten?« fragte Philon als erstes.
»Ich glaube, er wird es überstehen«, erwiderte ich zufrieden und ging in mein Zimmer hinauf, um mich zu waschen.
6
Als wir in jenem Frühjahr eines Abends gerade von unserer Besuchsrunde nach Hause gekommen waren und die Frauen das Abendbrot vorbereiteten, klopfte es an der Tür. Ein dunkelhäutiger, bärtiger Bursche in einer zerlumpten Leinentunika stand davor und bat uns, nach seiner Frau zu sehen, die vor einigen Tagen niedergekommen war und jetzt hohes Fieber hatte. Er sagte, er arbeite als Maultiertreiber und müsse am nächsten Tag wieder aus der Stadt, um nach seinen Tieren zu sehen.
Philon seufzte, dann lächelte er mir zu. »Sie wird uns beide benötigen«, meinte er. So gingen wir also alle beide, um nach der Frau zu sehen. Zum Glück wohnte sie wenigstens sehr nahe, gerade eben auf der anderen Seite der Via Canopica, in der Nähe der Schiffswerft.
Es handelte sich um einen sehr schweren Fall von Kindbettfieber, der nur im Hospital ordentlich behandelt werden konnte. Wir schickten den Mann in die Nachbarschaft, um eine Amme für das Kind zu suchen.
Philon blieb bei der Frau, um ihr ein paar Arzneimittel zu geben, die das Fieber senken sollten, während ich mich auf die Suche nach einem Hospital machte. Insgeheim beschloß ich, außerdem noch etwas Brot und Wein für Philon zu besorgen. Es ist nicht so einfach, nach einem langen Tag mit leerem Magen ordentlich zu arbeiten.
Die Straße war eng, dunkel und menschenleer. Das Hospital, das wir für gewöhnlich für unsere Kranken in Anspruch nahmen, lag in westlicher Richtung, in der Nähe des Pharosfelsens, der den Großen Hafen vom Eunostoshafen trennt. Vor der Haustür hielt ich einen Augenblick inne und fragte mich, ob ich über die Via Canopica gehen oder den Weg etwas abschneiden und die rückwärtigen Straßen zum Hafen nehmen sollte. Dann trug eine heftige Windbö das Geräusch eines Kampfgetöses aus dem östlichen Teil der Hafenanlagen nahe der Zitadelle zu mir herüber: undeutliches Grölen, lautes Rufen, das Splittern von etwas, das zerbrach. Ich fragte mich, was da los
Weitere Kostenlose Bücher