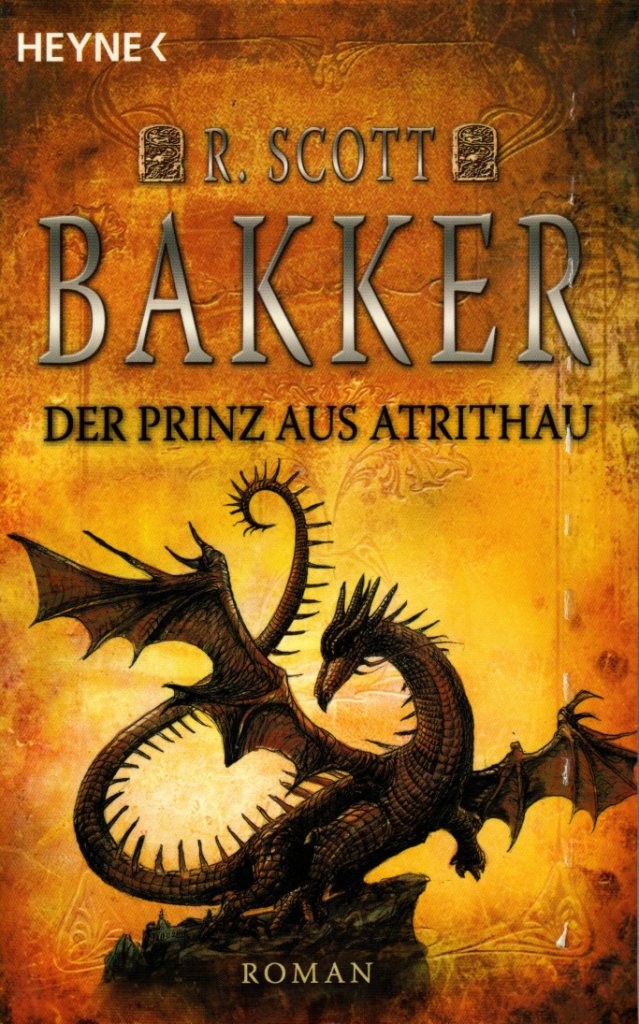![Der Prinz von Atrithau]()
Der Prinz von Atrithau
Wange an seinen linken Schenkel. Obwohl sich ihr der Magen umdrehte, konnte sie nicht erbrechen.
»Ich…«, schluchzte sie, »ich…«
»Du hast guten Glaubens gehandelt.«
Sie drehte sich zu ihm, und ihr Gesicht verzog sich.
Aber das warst nicht du, Kellhus!
»Du wurdest getäuscht und hast guten Glaubens gehandelt.«
Er wischte ihre Tränen ab, und sie sah Blut auf seinem Tuch. Eine Zeit lang lagen sie still da und sahen sich nur in die Augen. Sie spürte, wie das Stechen ihrer Haut nachließ und ihre Schmerzen sich langsam zu einem seltsamen Unwohlsein verflüchtigten. Wie lange sie wohl in diese Augen würde starren, wie lange ihr Herz sich in dem allwissenden Blick würde sonnen können?
Für immer?
Für immer!
»Der Scylvendi kam und wollte mich mitnehmen«, sagte sie schließlich.
»Ich weiß«, antwortete Kellhus. »Ich hab es ihm erlaubt.«
Irgendwie hatte sie auch das gewusst.
Aber warum?
Er strahlte.
»Weil ich wusste, dass du es ihm nicht erlauben würdest.«
Was haben sie wohl alles erfahren?
Im einsamen Schein einer Lampe redete Kellhus zärtlich und im Rhythmus ihres Herzschlags und ihres Atems auf das Mädchen ein. Mit schier übermenschlicher Geduld versetzte er sie langsam in jene Trance, die die Dûnyain Verhüllung nannten – in den Zustand also, in dem eine Stimme eine andere überschreiben konnte. Er entlockte ihr viele Antworten, die sie ihm ganz abwesend gab, und erlebte das Verhör des Hautkundschafters so noch einmal mit. Dann schabte er dessen Angriff vorsichtig vom Pergament ihrer Seele. Am Morgen würde sie sich über ihre Schnitte und blauen Flecke wundern – mehr nicht. Sie würde gereinigt aufwachen.
Danach schob er sich durchs Lager, in dem überall laut gefeiert wurde, und schlug den Weg zum Meneanor-Meer ein, wo der Scylvendi sein Lager aufgeschlagen hatte. Er reagierte nicht auf die vielen, die ihm zujubelten, sondern mimte nachdenkliche Zerstreutheit, die der Wahrheit freilich recht nahe kam. Wer nicht locker ließ, schrak schließlich vor seinem wütenden Blick zurück.
Er hatte noch eine Aufgabe zu erledigen.
Keiner, mit dem er sich bisher beschäftigt hatte, war so vielschichtig und gefährlich wie der Scylvendi. Da war sein Stolz, der ihn – wie Proyas und die anderen Hohen Herren – hochgradig empfindlich auf jede Bevormundung reagieren ließ. Und da war seine enorme Intelligenz, die ihn die Bewegungen seiner Seele nicht nur erfassen und durchdringen, sondern auch reflektieren ließ, ihm also erlaubte, nach dem Ursprung seiner Gedanken zu fragen.
Noch gefährlicher aber war sein Wissen über die Dûnyain. Moënghus hatte ihm vor Jahren, um den Utemot zu entkommen, zu viel Wahrheit zugänglich gemacht und unterschätzt, was Cnaiür mit diesen Bruchstücken anfangen könnte. Die besessene Beschäftigung mit den Ereignissen, die zum Tod seines Vaters führten, hatte den Steppenbewohner zu vielen beunruhigenden Schlüssen kommen lassen. Und nun kannte allein er die Wahrheit über die Dûnyain. Nur er war wach und im Bilde.
Und darum musste er sterben.
Fast alle Menschen waren den Sitten und Gebräuchen ihrer Landsleute gedankenlos verhaftet. Die Männer aus Conriya rasierten sich nicht, weil sie nackte Wangen für verweichlicht hielten. Die Nansur trugen keine Beinkleider, da sie ihnen als primitiv galten. Die Tydonni verkehrten nicht mit dunkelhäutigen Menschen (die sie Pickel nannten), weil sie angeblich schmutzig waren. Sie alle nahmen solche Regeln als selbstverständlich hin. Sie brachten Statuen kostbare Speisen als Opfer dar, küssten die Knie schwächerer Männer und lebten in panischer Angst vor den eigenen Gelüsten. Sie hielten sich jeweils für das Maß aller Dinge und empfanden Scham, Ekel, Wertschätzung, Verehrung, ohne je nach dem Warum zu fragen.
Bei Cnaiür war das anders. Während die Übrigen den Traditionen in Unkenntnis von Alternativen folgten, musste er dauernd wählen und sich – wichtiger noch – bewusst für einen Gedanken aus der Unsumme möglicher Gedanken, für eine Tat aus der Unmenge möglicher Taten entscheiden. Warum eine Frau rügen, wenn sie weint? Warum sie nicht stattdessen schlagen? Oder lachen, ihren Kummer ignorieren oder sie trösten? Warum nicht mit ihr weinen? Was machte eine Antwort wahrer als die andere? War es die eigene Herkunft? Waren es die einsichtigen Worte anderer? Oder der Glaube?
Oder hing die Antwort – wie Moënghus behauptet hatte – davon ab, welches Ziel man verfolgte?
Obwohl in
Weitere Kostenlose Bücher