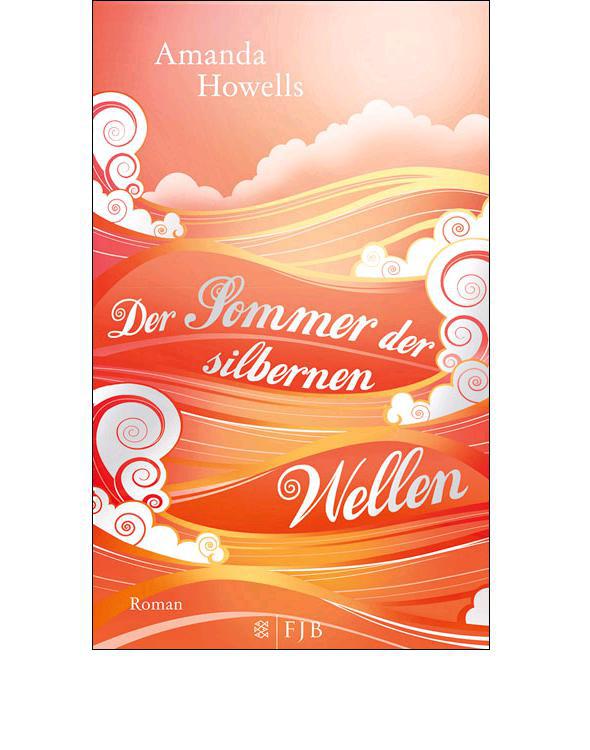![Der Sommer der silbernen Wellen: Roman (German Edition)]()
Der Sommer der silbernen Wellen: Roman (German Edition)
Zeit und Raum aus, wo niemand außer uns existierte.
Bei Tageslicht schien alles anders. Simon sah anders aus. Er war attraktiver, als ich gedacht hatte. Seine Haare hatten die Farbe von dunklem Kupfer und seine Augen waren intensiv graublau mit kleinen Lichtfunken darin. Es war merkwürdig, einander richtig anzusehen, sich deutlich erkennen zu können. Mir fiel auf, wie seltsam es war, dass ich wegen unserer ausschließlich nächtlichen Treffen nicht mal gewusst hatte, welche Farbe Simons Augen hatten. Und jetzt, wo ich hineinsehen konnte, schaute ich weg.
Denn ich wusste, dass ich bei Tag keineswegs besser aussah als bei Nacht. Es hätte mir nichts ausmachen sollen, weil wir schließlich nur Freunde waren, aber als ich an jenem ersten Tag Simon den Strand entlangkommen sah, war ich plötzlich angespannt.
Egal, wie oft wir darüber geredet hatten, dass Mädchen wie Stacy und Corinne nicht mehr Simons »Typ« waren. Egal, wie oft er betont hatte, nicht mehr dasselbe Interesse an oberflächlichen Dingen und Leuten wie früher zu haben. Und egal, wie sehr mir tief im Inneren klar war, dass ich völlig okay war und eine ganz normale Figur hatte – ich konnte mich einfach nicht entspannt und selbstsicher verhalten, wenn ich in meinem marineblauen Bikini am Strand neben diesen dünnen, modellhaften, seidenhaarigen Grazien lag. Besonders, weil Simon den krassen Unterschied deutlich bemerken musste.
»Hey«, grüßte Simon lässig, als er an jenem Nachmittag am Strand auf mich, meine Cousinen und Gen zuschlenderte.
»Wow!«, lästerte Gen und musterte Simon cool einmal von Kopf bis Fuß durch ihre Sonnenbrille. »Ist das etwa eine Seersucker-Kappe? Mann, ist das stupidus! Du erinnerst mich an meinen Lateinlehrer.«
»Latein?« Simon zog in gespieltem Entsetzen die Nase kraus.
»Gen ist ein Ass in Latein«, erklärte Corinne kichernd, »großes Latinum, das muss es schon sein. Wir haben nicht mal Latein in der Schule, aber hat sie ihren eigenen Privatlehrer.«
»Sei still!«, sagte Gen.
»Apropos stupidus!«, erwiderte Simon. »Ich gehe lieber wieder. Mit so vielen stupidae maximae will ich nicht gerne gesehen werden.«
Sogar Gen musste darüber lachen. Mit solchen Witzen schaffte es Simon, bei Corinne und Gen das Eis zu brechen. Sie respektieren einen, wenn man lustig war, sogar, wenn man sich über sie lustig machte.
Doch während rings um mich die Unterhaltung in Gang kam, dachte ich über meine nächtlichen Gespräche mit Simon nach. Patchogue. Rockaway. Shinnecock. Und ich wünschte, ich wäre dort in der Dunkelheit anstatt hier, umgeben von all diesen dünnen Mädchen und nur zwei kleinen Fetzen Lycra zwischen mir und der Außenwelt.
Nicht zuletzt fühlte ich mich heuchlerisch, als ich mit Simon und meinen Cousinen zusammensaß und mein Tages- und Nachtleben aufeinanderprallten. Ich hatte begonnen, einige meiner Zweifel im Hinblick auf Corinne und Co. mit Simon zu teilen. Ich hatte ihm erzählt, dass ich mich nicht dazugehörig fühlte. Aber trotzdem saß ich hier und gab mir weiter Mühe. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, keine andere Wahl zu haben. Ging es Simon genauso? Oder gesellte er sich nur zu den anderen, um mit mir zusammen zu sein?
Natürlich hast du eine Wahl!, raunzte mich meine innere Stimme an. Keiner hielt mir eine Pistole an den Kopf, und seit wann himmelte ich Leute an, nur weil sie schön waren?
Doch mein inneres Kreuzverhör half nichts. Ich wurde von meinen Cousinen und ihrem Universum magnetisch angezogen, unfähig, mich loszureißen. Vielleicht lagen die Wurzeln schon in meiner frühen Kindheit. Immer wenn ich die glamouröse Tante Kathleen mit ihrem gutaussehenden blonden Gatten und ihren engelsgleichen Töchtern gesehen hatte, wirkten sie so glücklich, so strahlend und perfekt.
Einmal, kurz nachdem sie Wind Song gekauft hatten, hatte meine Tante uns ein Foto der Familie im Yachthafen von Southampton geschickt. Die Mädchen, meine Tante und mein Onkel trugen alle die gleichen blauweiß gestreiften T-Shirts und blickend lachend in die Kamera, während mein Onkel eine Flasche Champagner am Bug ihrer brandneuen Yacht zerschellen ließ.
Fasziniert hatte ich das Bild angestarrt, das mit einem Brief meiner Tante eingetroffen war. Ich beneidete die Familie nicht, als ich in ihre schönen Gesichter blickte. Ich bewunderte sie zu sehr, um neidisch zu sein, und außerdem schien ihre Schönheit nicht nur oberflächlich zu sein. Sie war wie ein Siegel für Glück und Güte, ein
Weitere Kostenlose Bücher