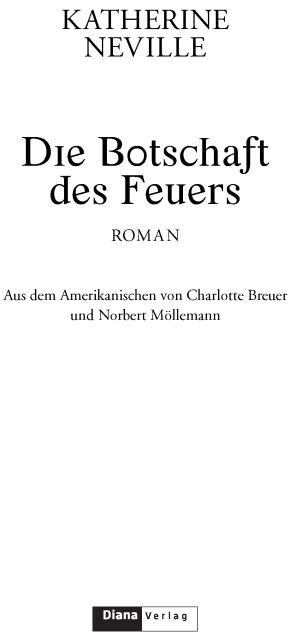![Die Botschaft des Feuers]()
Die Botschaft des Feuers
Gefühl hatte, eine komplette Versagerin zu sein, drängte Slawa mich, eine schlecht bezahlte Lehrstelle anzutreten - Aussteiger, Drückeberger, Penner, Schwätzer unerwünscht -, und zwar im einzigen Vier-Sterne-Restaurant der Welt, das sich ausschließlich auf das Kochen über offenem Feuer spezialisiert hatte.
Nachdem ich vier meiner fünf Lehrjahre hinter mich gebracht hatte, musste ich mir, wenn ich mich im Spiegel betrachtete, eingestehen, dass ich - obwohl ich mitten in der Hauptstadt der Nation wohnte - genauso eine Einzelgängerin geworden war wie meine Mutter, die sich auf ihren eigenen Berg in Colorado zurückgezogen hatte.
Immerhin konnte ich mit einer Erklärung aufwarten: Ich war vertraglich an Monsieur Rodolfo Boujaron gebunden, den Sklaventreiber-Restaurantbesitzer-Unternehmer, der mein Chef, mein Mentor und mein Vermieter in Personalunion
war. Solange Rodo die sprichwörtliche Peitsche schwang, blieb mir einfach keine Zeit für ein Leben in Geselligkeit.
Tatsächlich war es so, dass der mich voll in Anspruch nehmende Job, zu dem mein Onkel mich fürsorglicherweise verdonnert hatte, mir genau die Struktur bescherte - die Übung, die Anspannung, die Regelmäßigkeit -, die mir so schmerzlich gefehlt hatte, seit ich nach dem Tod meines Vaters das Schachspielen aufgegeben hatte. Die Aufgabe, jeden Freitag das Feuer anzufachen und es die ganze Woche über in Gang zu halten, verlangte ebenso viel Fürsorge und Gewissenhaftigkeit wie die Pflege eines Säuglings oder eines Wurfs Welpen: Man durfte sich nicht eine Sekunde lang ablenken lassen.
Aber wenn der Spiegel mir die Wahrheit über mich selbst sagte, dann musste ich zugeben, dass mein Job mir in den vergangenen vier Jahren viel mehr gegeben hatte als nur Struktur oder Durchhaltevermögen oder Disziplin. Das Leben mit dem Feuer - Tag für Tag die Flammen zu beobachten, um die Hitze zu kontrollieren - hatte mich eine neue Art zu sehen gelehrt. Und dank Rodos Schmährede hatte ich gerade etwas Neues gesehen, nämlich dass meine Mutter mir noch einen weiteren Hinweis hinterlassen hatte, und zwar einen, der mir gleich hätte ins Auge springen müssen, als ich das Haus betrat.
Das Feuer. Wie war es überhaupt möglich, dass es unter den gegebenen Umständen brannte?
Ich hockte mich vor den Kamin, um das dicke Scheit näher in Augenschein zu nehmen. Es war ein abgelagerter Meterstamm von einer Weymouthkiefer, der wesentlich schneller verbrennen würde als ein Scheit aus dem Hartholz eines Laubbaums. Obwohl meine Mutter, die schließlich aus den Bergen stammte, wusste, wie man ein Feuer aufbaute, blieb die Frage, wie sie dieses Feuer ohne langwierige Planung -
und vor allem ohne fremde Hilfe - hatte in Gang bringen können.
Seit ich vor etwa einer Stunde gekommen war, hatte niemand Holz nachgelegt oder die Glut mit einem Blasebalg angefacht oder irgendetwas unternommen, um die Hitze hochzutreiben, und dennoch schlugen die Flammen mindestens zwanzig Zentimeter hoch, was bedeutete, dass es vor mindestens drei Stunden angezündet worden war. Und so gleichmäßig, wie es brannte, musste sich irgendjemand anschließend noch länger als eine Stunde um das Feuer gekümmert haben.
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Das bedeutete also, dass meine Mutter erst vor Kurzem, vielleicht eine halbe Stunde vor meiner Ankunft, aufgebrochen war. Aber wohin? Und war sie allein unterwegs? Und wenn sie - mit oder ohne Begleiter - das Haus durch eine Tür oder ein Fenster verlassen hatte, warum waren dann im Schnee keine Spuren außer meinen eigenen zu sehen?
Mir schwirrte der Kopf von all den Hinweisen, die nichts weiter als Hintergrundrauschen hervorzubringen schienen. Dann fiel mir noch etwas Merkwürdiges auf: Woher hatte Rodo gewusst, dass ich zu einer boum d’anniversaire gefahren war, wie er sich ausgedrückt hatte - zu einer Geburtstagsparty? Weil meine Mutter ihr Leben lang so ein Geheimnis um ihr Geburtsdatum machte, hatte ich niemandem den Grund für meine plötzliche Reise genannt - nicht einmal Leda, wie Rodo in seiner Nachricht gemeint hatte. Aber egal, wie verworren mir das alles erschien, ich war mir sicher, dass es irgendwo ein verborgenes Motiv für das Verschwinden meiner Mutter geben musste. Und es gab nur einen Ort, an dem ich noch nicht gesucht hatte.
Ich zog die hölzerne schwarze Dame, die ich vom Billardtisch genommen hatte, aus meiner Hosentasche. Mit dem
Daumennagel kratzte ich das runde Filzstück ab, das unter ihrem Fuß klebte. Die Figur
Weitere Kostenlose Bücher