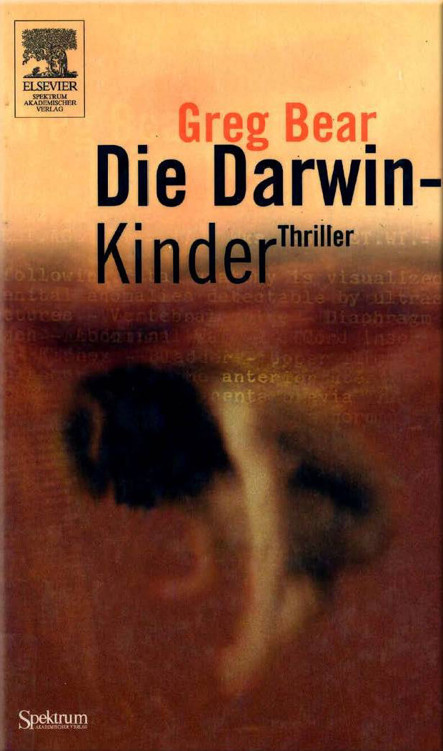![Die Darwin-Kinder]()
Die Darwin-Kinder
Staubflocken und Stoffkatzen unter dem Bett und tastete sich weit in die Schatten vor. Das Buch war nicht mehr da.
Der innere Frieden war nichts als Selbsttäuschung, eine Falle, es gab niemals Ruhe, nie hätte sie in ihrer Wachsamkeit nachlassen dürfen. Stella war verschwunden. Sie hatte das Buch mitgenommen, und das bedeutete, dass es ihr Ernst war.
Immer noch in Pantoffeln, drängte sich Kaye durchs Tor und rannte die von Eichen gesäumte Straße entlang. »Bloß keine Panik«, flüsterte sie vor sich hin, »reiß dich zusammen, verdammt noch mal.« Ihre Nackenmuskeln verkrampften sich.
Als sie vierhundert Meter weiter vor dem nächsten Haus an der Straße angekommen war – es war eine ländliche Gegend –
verlangsamte sie ihren Schritt und blieb mitten auf dem von Rissen durchzogenen Asphalt stehen. Niedergedrückt und angespannt, wie eine Maus, die den Habicht erwartet, schlang sie die Arme um sich.
Kaye schirmte die Augen gegen die Sonne ab und sah zu den dicken grauen Wolken empor, die dicht an dicht am südlichen Horizont vorrückten. Die Luft roch so, als braue sich etwas Düsteres zusammen.
Falls Stella das hier geplant hatte, musste sie weggelaufen sein, nachdem Mitch nach Washington aufgebrochen war.
Mitch hatte das Haus zwischen sechs und sieben Uhr morgens verlassen. Das bedeutete, dass ihre Tochter einen Vorsprung von mindestens einer Stunde hatte. Bei dieser Erkenntnis lief Kaye ein kalter Schauer über den Rücken.
Es war nicht ratsam, die Polizei einzuschalten. Vor fünf Jahren hatte Virginia sich widerwillig dem Krisenstab gefügt und damit begonnen, die neuartigen Kinder einzukreisen und festzunehmen, um sie auf Lager in Iowa, Nebraska und Ohio zu verteilen. Schon vor Jahren hatten sich Kaye und Mitch aus geheimen Elterninitiativen zurückgezogen, nachdem das FBI dort jede Menge Agenten eingeschleust hatte. Mitch war davon ausgegangen, dass sie Kaye ganz besonders aufs Korn nehmen würden, um sie zu überwachen und vielleicht sogar zu verhaften.
Sie waren allein auf sich gestellt, nachdem sie zur Überzeugung gelangt waren, dass dies am sichersten war.
Kaye streifte die Pantoffeln ab und rannte barfuß zurück zum Haus. Sie musste sich in Stella hineinversetzen, und das war nicht einfach. Als Mutter wie als Wissenschaftlerin hatte Kaye ihre Tochter nun elf Jahre lang beobachtet, und über all die Jahre war da eine winzige, aber wesentliche Distanz zwischen ihnen geblieben, die sie nicht überbrücken konnte. Stella dachte mit einer Gründlichkeit nach, die Kaye bewunderte, gelangte aber oft zu Schlussfolgerungen, die Kaye kaum nachvollziehen konnte.
Kaye griff nach ihrer Handtasche mit Geldbörse und Ausweis, zog ihre Gartenschuhe an und ging durch die Hintertür hinaus. Der kleine graue Lastwagen, ein Toyota mit Einspritzvorrichtung, sprang sofort an. Mitch wartete und pflegte ihre beiden Wagen. Mit knirschenden Reifen raste sie die ungepflasterte Auffahrt hoch, riss sich aber gleich am Riemen und drosselte das Tempo, als sie die Landstraße entlangfuhr.
»Nur das nicht, bitte«, murmelte sie. »Ich hoffe nur, du bist in kein Auto gestiegen.«
8
Während Stella am unbefestigten Rand der Asphaltstraße entlangging, schwang sie die Plastikflasche mit der Limonade hin und her, aus der sie sich nur alle paar Minuten einen Schluck genehmigte. Zu ihrer Rechten erstreckte sich altes Ackerland, das mittlerweile umgepflügt und als Bauland für ein neues Einkaufszentrum ausgewiesen war. Stella balancierte auf einem gerade erst ausgehärteten Betonfundament entlang, das noch immer in seiner Gussform lag. Am östlichen Himmel stieg die Sonne jetzt höher, während sich im Süden dunkle Wolken verdichteten. Verschiedene Gerüche wirbelten durch die heiße Luft: der Duft von Hartriegelpflanzen, der von Maulbeerbäumen. Die Abgase der vorbeifahrenden Autos und die Wolke von Kohlenstoffpartikeln, die ein Diesellaster hinterließ, verstopften Stella die Nase.
Endlich einmal hatte sie das Gefühl, etwas zu unternehmen, das sich lohnte. Selbstverständlich hatte sie auch ein schlechtes Gewissen, aber sie verdrängte den Gedanken daran, was ihre Eltern wohl empfinden mochten. Vielleicht würde sie irgendwo auf dieser Straße einen Menschen treffen, mit dem sie instinktiv klar kam, jemanden, der nicht schon an ihrer bloßen Existenz Anstoß nahm. Jemanden, der so war wie sie.
Ihr ganzes bisheriges Leben hatte sie mit einer ganz bestimmten Sorte von Menschen verbracht, zu der sie selbst nicht
Weitere Kostenlose Bücher