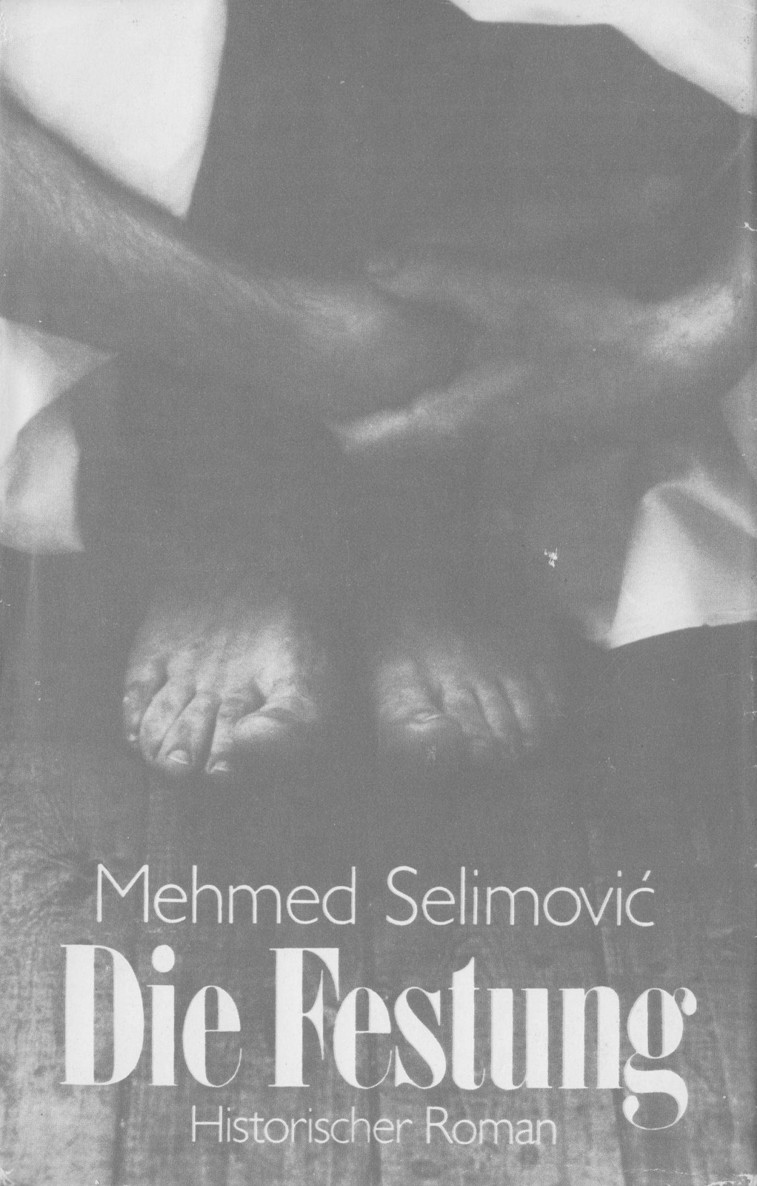![Die Festung]()
Die Festung
ihr
versprochen, sie nicht allein zu lassen. Nun ließ sie mich allein, und es fiel
ihr nicht schwer. Dennoch überwog der vernünftige Gedanke, daß es so besser
war, sie würde sich Bewegung machen, das brauchte sie, sich aussprechen, sich
unterhalten, sie würde beschäftigt sein und nicht an ihre Angst und den Tod
denken. Es würde weniger Grund zum Streit geben.
Aber was sollte ich machen? Ich
hatte mir gewünscht, so frei zu sein, und jetzt wußte ich nicht wohin mit mir
und meiner Freiheit. Ins Kaffeehaus mochte ich nicht gehen, die Leute erzählten
immer dasselbe, und ich schwieg dazu.
Sollte ich wie ein Narr durch die
Straßen schlendern? Lächerlich, sinnlos.
Zum Fluß zu gehen, ins Wasser zu
starren kam mir nicht in den Sinn. Weil es schneite, weil ich kein Bedürfnis
verspürte, weil ich vor nichts davonlief. Ich war nicht mehr unausgefüllt, ich
wußte nicht, was ich war, aber Leere und Einsamkeit spürte ich nicht.
Dann verfiel ich auf Bücher. Sie
waren nicht der ganze Mensch, sondern sein Bestes, das, was er in erwählten
Augenblicken war. Mit diesem lebendigen Menschen, der dennoch nicht
gegenwärtig war, konnte man sprechen, sich wohl fühlen, und man brauchte ihm
nicht zu danken. Man konnte mit ihm streiten, und er vermochte nichts anderes
zu erwidern, als was er schon geschrieben hatte. Man konnte sich mit Weisheit
brüsten, indem man ihm Dummheiten sagte, er würde geduldig zuhören. Man konnte
ihn stehenlassen und zu einem anderen gehen, er würde es nicht übelnehmen. Er
würde einen herzlich empfangen, wenn man zu ihm zurückkam, denn er war immer
zum Gespräch bereit.
Ich
verzichtete auf dieses Gespräch in der Bibliothek.
Am Ende beschloß ich, Mula Ibrahim
aufzusuchen, um zu hören, was er von Ramiz wußte, um ihm zu sagen, daß ich bei Šehaga
nichts ausgerichtet hatte, um über Alltägliches zu reden, nicht über ewige
Dinge, nicht heute, ich konnte nicht ohne Menschen sein, und er stand mir am
nächsten, wie er auch immer sein mochte. Er hatte mir geholfen, solange er
durfte, er hatte auch helfen wollen, als er nicht durfte, und es war nicht
seine Schuld, daß er anders war, als ich mir gewünscht hätte. Und das bedauerte
ich mehr, als daß ich mich darüber aufregte.
Im Laden traf ich Šehaga Sočo
und Mula Ibrahim bei einem Gespräch an, das mir interessant erschien. Šehaga
winkte mir zu, Mula Ibrahim nicht einmal das. Er hörte Šehaga nachdenklich und
ernst zu. Šehaga hielt nur kurz inne, um mir einen unzufriedenen Blick
zuzuwerfen, weil ich als ungebetener Dritter sein Geständnis unterbrach, das
er aus innerem Bedürfnis ablegte, ermutigt durch eine gewisse Übereinstimmung,
ein gewisses Klima zwischen ihnen beiden. Aber offenbar war eine große Armee
ungeduldiger Worte hinter seiner Stirn angetreten, der er den Weg freigeben
mußte, er hatte erst wenig gesagt und würde nun fortfahren, allein sich selbst,
nicht Mula Ibrahim oder mir zuliebe. Er suchte lediglich Verständnis oder
schweigende Aufmerksamkeit. Bei Mula Ibrahim würde er beides finden. Ich würde
nur schweigen.
Der Mensch strebe nach der Macht
(sagte er, an Mula Ibrahim gewandt). Weil er lebe, weil er sich bewege, weil er
mit Menschen zusammenträfe. Und er wolle etwas zurücklassen, etwas schaffen,
nicht nur vegetieren wie ein Baum. Und er bilde sich ein, etwas erreicht zu
haben, stark und bedeutend zu sein, viel zu vermögen. Aber plötzlich würde er
durch Gott sehend gemacht und erkenne, daß er nur ein Sandkörnchen in der
unabsehbaren Wüste dieser Welt sei, winzig und bedeutungslos wie eine Ameise im
Bau. Strebten die Ameisen nach der Macht? Wollten sie stärker und bedeutender
als andere sein? Hatten sie ihre Sorgen, Nöte, schlaflosen Nächte, Stunden der
Verzweiflung? Wir wußten es nicht, und es kümmerte uns nicht, sie waren für uns
zu winzig. Konnte demnach nicht auch jemand existieren, der größer war als wir,
dem unsere Sorgen und Nöte nichts bedeuteten? Wir sahen ihn nicht,
denn er war uns unvorstellbar, wir spürten seine Anwesenheit nur, wenn sich
sein Wille durch etwas offenbarte. Auch die Ameise sah nicht den ganzen
Menschen, wegen seiner Größe existierte er gar nicht für sie, sie sah nur den
Finger oder das Zweiglein, mit dem wir ihr den Weg versperrten, sie fühlte das
Erdbeben, wenn wir ihren Bau zerstörten. Der Mensch aber war gegenüber dem
Weltall kleiner als eine Ameise. Und warum sollte es nur den Menschen geben und
seine Art zu denken? Die Welt war vor uns dagewesen, sie
Weitere Kostenlose Bücher