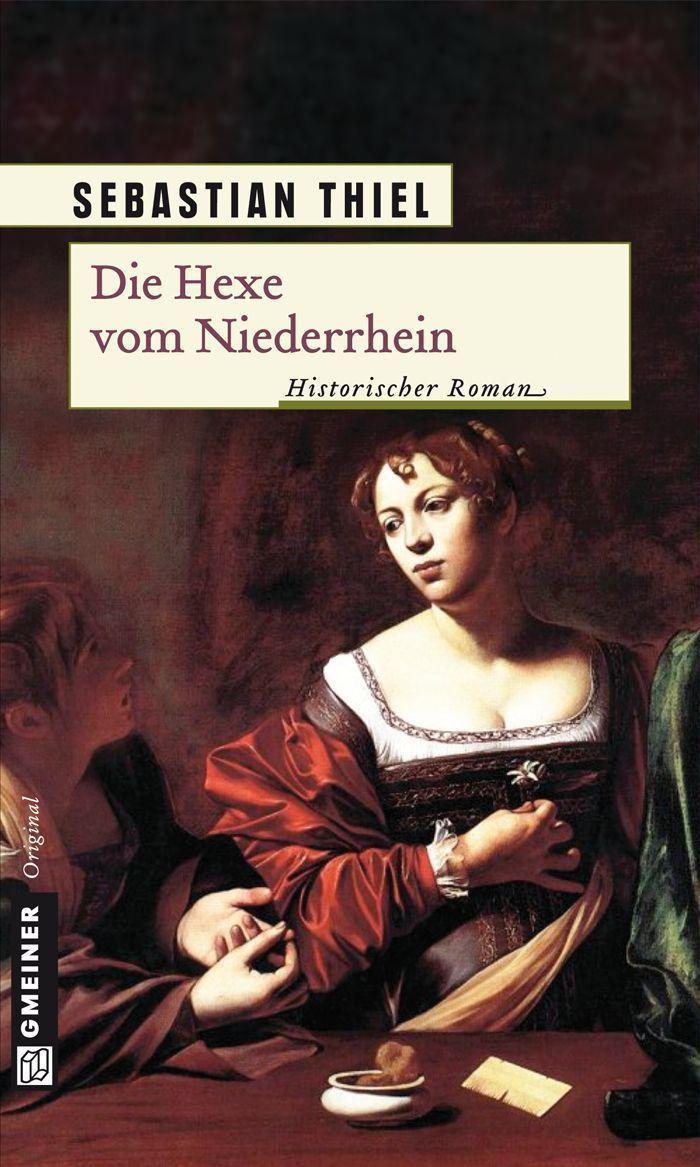![Die Hexe vom Niederrhein: Historischer Roman (German Edition)]()
Die Hexe vom Niederrhein: Historischer Roman (German Edition)
er
und er musste über sich selbst lachen. Es waren nur die Gedanken eines Wirren, der
annehmen konnte, dass Antonella auch in dieser Nacht dort sein könnte. Jetzt, da
der Krieg das Land mit seinem dunklen Antlitz überzogen hatte. Gebückt drehte er
sich um. Die Schwärze der Nacht selbst drang in ihn hinein. Sie zerrte ihn unbarmherzig
hinunter, zog ihn auf den Boden und befahl ihm, die Augen zu schließen.
»Lorenz! Lorenz!«
Diese Stimme …
… sie schien nicht von dieser Welt zu stammen. So zärtlich und süß
und doch ängstlich und verzweifelt drang sie in seine Ohren. Seine Lider öffneten
sich einen Spalt weit, als er in die Augen von Antonella blickte.
»Ein Traum …«, hauchte er.
Ja, dies musste ein Traum sein. Ein letzter, perfekter Traum, der ihm
vom Allmächtigen geschenkt wurde, bevor er endgültig von dieser Welt Abschied nehmen
musste. Lorenz lächelte.
»Du bist nicht bei Sinnen«, sagte Antonella hektisch, während sie seinen
Kopf anhob.
»Ein wunderschöner Traum …«
»Du bist zurück! Dies ist wahrlich ein Traum«, flüsterte sie.
Vorsichtig umarmte sie ihn. »Du bist verletzt und halb ausgehungert.
Ich muss …«
Sie beendete den Satz nicht, sondern packte Lorenz und zog ihn ächzend
in den Wald hinein. Er spürte die Berührungen auf seiner Haut und genoss den Duft
ihrer Haare.
»Ein wunderschöner Traum …«, wisperte Lorenz, als er erneut die Augen
schloss.
Die Kühle des Wassers fühlte sich unendlich gut an. Zärtlich strich
Antonella ihm mit einem Lappen über das Gesicht, genau darauf bedacht, Lorenz nicht
zu wecken. Es dauerte nur wenige Minuten, bis er sein Gesicht an ihre Hand drückte
und leise stöhnte.
»Lorenz«, flüsterte sie.
Halb in dieser Welt und halb in der Traumwelt, blickte er sie an. Konnte
dies wirklich wahr sein? Schaute er gerade wirklich in die rehbraunen Augen von
Antonella?
»Bist du es wirklich?«, fragte er ohne Stimme.
Ihr scheues Nicken und ihre Augen, die tief in seine Seele zu blicken
schienen, gaben ihm Gewissheit. Die Schmerzen ignorierte er, als er sich aufrichtete
und sie küsste. Er wollte ihr so viel sagen, so viele Fragen stellen, doch in seinem
Kopf herrschte Chaos. Verstehend drückte sie behutsam einen Finger auf seinen Mund
und ließ die Lippen folgen.
»Du brauchst Ruhe. Leg dich wieder hin«, hauchte sie. »Hier, trink.«
Das Gebräu ähnelte dem, das ihm von der Frau in Crefeld eingeflößt
worden war, nicht nur in seinem widerlichen Geschmack, sondern auch in der Wirkung,
die seinen Blick klarer machte und seinen Verstand langsam zurückkommen ließ. Zärtlich
nahm sie seine Hand, zog sie hoch und küsste sie. Ihre Augen glänzten, doch Lorenz
las in ihnen etwas, das er nicht verstand. Antonella bebte, erst leicht, dann brach
es schluchzend aus ihr heraus.
»Ich habe jeden Tag gehofft, dass ich dich wiedersehe.« Antonellas
Augen füllten sich mit Tränen und ihre Unterlippe begann zu zittern. »Irgendwann
habe ich aufgehört, zu hoffen.«
Ihr weißes Gesicht wirkte auch im Schein des Ofenfeuers fahl und kraftlos.
Lorenz konnte die Worte, die ihre Lippen verließen, beinahe nicht verstehen, und
doch genoss er jede Silbe. Auch er war den Tränen nahe. Langsam zog er sie an sich
heran, obwohl jede Bewegung wie eine Folter durch das Höllenfeuer selbst war. Als
ihr Kopf neben seinem auf dem kleinen Bett in ihrer Hütte lag, rannen bei Lorenz
die Tränen in Bächen die Wangen hinunter.
»Ich liebe dich, Antonella«, hauchte er ihr ins Ohr.
Er roch den Duft ihrer Haut, spürte ihren Körper auf seinem atmen,
doch es war nichts im Vergleich zu dem, was ihr Blick in seiner Seele auslöste,
als sie sein Gesicht in beide Hände nahm und ihm tief in die Augen sah.
»Ich liebe dich auch, Lorenz«, wisperte sie.
Für einige Sekunden verharrten die beiden eng aneinandergeschmiegt.
Fest umarmten sie sich, aus Angst, dass, wenn sie loslassen würden, dieser Traum
zu Ende sein könnte. Sie starrten in das knisternde Feuer des Ofens, als würden
die Flammen ihre lodernde Liebe bezeugen. Es war Lorenz’ Stöhnen, das die Idylle
unterbrach. Besorgt schrak Antonella hoch.
»Was ist mit deinem Kopf?«, fragte sie, seinen Verband untersuchend.
»Ich weiß nicht«, antwortete Lorenz, während er versuchte, sich abzustützen.
»Mir ist schummrig und übel. Außerdem möchte ich die ganze Zeit schlafen, es ist
wie eine lange, anhaltende Müdigkeit, der ich mich nur schwer entziehen kann«, stöhnte
er.
»Du brauchst Arzneien.
Weitere Kostenlose Bücher