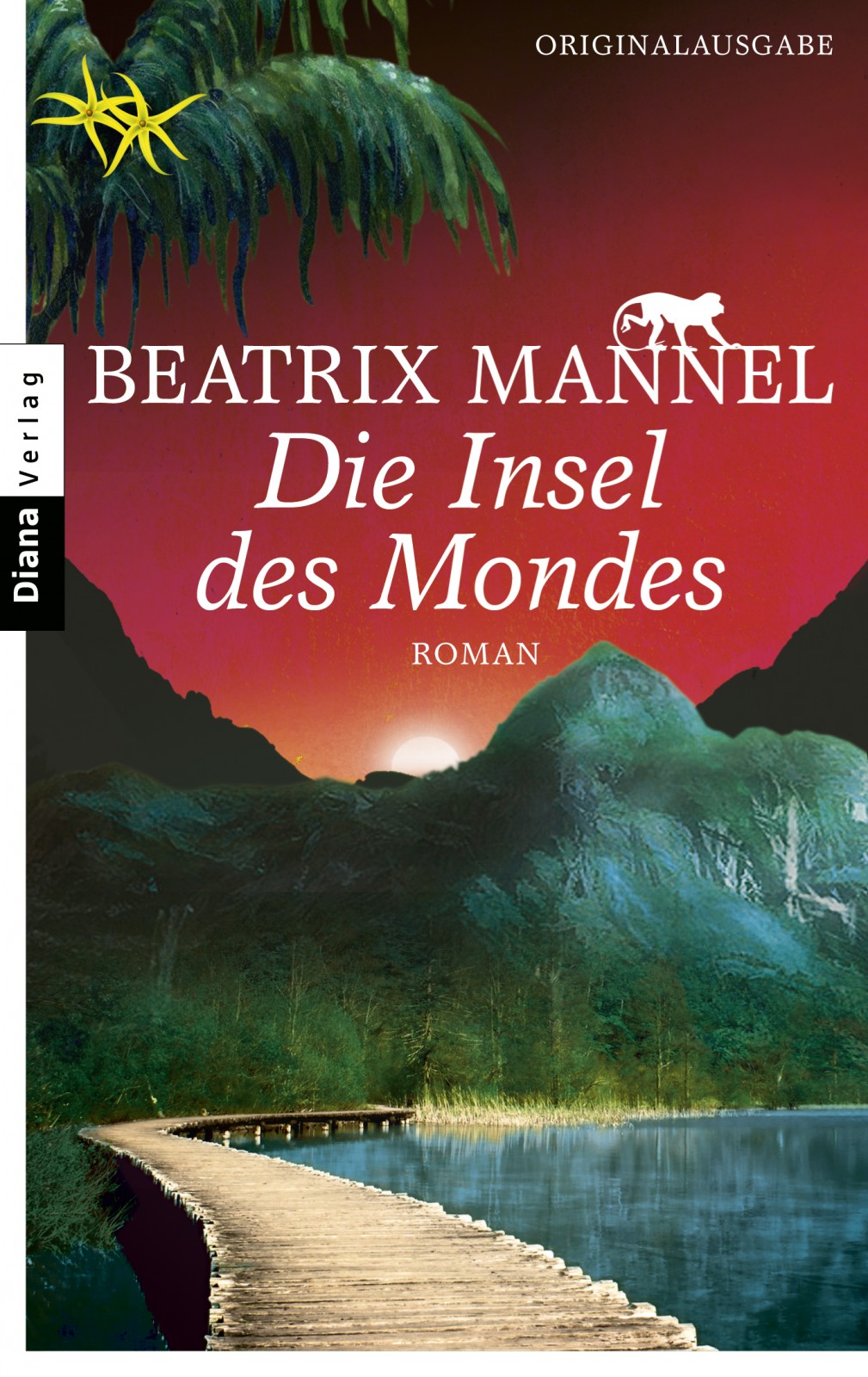![Die Insel des Mondes]()
Die Insel des Mondes
noch dazu wollte sie allen Ernstes das Kind auf unserer Flucht mitschleppen, was ich ihr gerade noch ausreden konnte, der Kleine ist doch nur Ballast und nicht einmal ihr Kind.
Natürlich war diese ganze Diskussion nur deshalb nötig, um möglichst lange die Illusion aufrechtzuerhalten, dass ich mit Noria teilen und sie auf meiner Flucht mitnehmen würde. Sie war mir nützlich wie ein großartiger Jagdhund, aber jetzt ist meine Jagd beendet, und ich habe keine Lust, einen Hund durchzufüttern, der sich leicht selbst ernähren kann.
Von dem Gold muss ich die Plantage zurückkaufen, und dort will ich niemanden sehen, der mich an etwas erinnert, was ich gerne für immer vergessen möchte. Für sie habe ich mir etwas Hübsches ausgedacht. Das Beste wäre natürlich, sie zu töten, aber das erschien mir zu unpassend für Noria, die mir ja über weite Strecken eine gute Kameradin war.
Nachdem wir die ganze Nacht durchmarschiert sind, hat sie in der Morgendämmerung unseren Lagerplatz direkt an einem Mangrovenfluss errichtet, der ins Meer mündet und von dem aus die Überfahrt nach St. Marie stattfindet. Dort werde ich nachher von einem Fischer abgeholt. Und von St. Marie geht es dann unverzüglich weiter nach Réunion.
»Jetzt möchte ich endlich das Gold sehen.« Noria schaut mich erwartungsvoll an, und ich finde, sie hat es verdient, die Früchte unserer Arbeit zu sehen, bevor ich sie ihr wegnehmen werde.
Wir setzen uns ans Feuer, wo sie schon unser Frühstück gekocht hat, Hühnersuppe mit Reis, der ich mit gutem Appetit zuspreche, ich fühle mich heute stark wie ein Bulle. Nichts kann mich mehr zurückhalten. »Es schmeckt köstlich, wie immer, Noria.« Sie schenkt mir einen kurzen Blick und zeigt auf die Blechdose, die vor uns steht.
Ich wische den dicken rötlichen Staub von Jahren vom Deckel und öffne ihn. Er ist ein wenig verklemmt, festgerostet, aber dann, mit etwas Gewalt, lockert er sich. Ich habe den Deckel in der Hand und erblicke endlich, was in der Dose ist.
Zuerst weigert sich mein Verstand zu glauben, was ich sehe, und ich muss sie unverzüglich herausholen, einen nach dem anderen, immer in der Hoffnung, darunter wäre dann das Gold.
Dabei kommt mir die Suppe wie saurer Essig wieder hoch.
»Das ist kein Gold.« Noria klingt, als würde sie lachen. »Das sind nur Steine.«
»Das sehe ich selbst.« Ich starre sie an und packe ihren Arm. »Du hast mich reingelegt, du Miststück. Wo hast du’s versteckt?«
Empört reißt sie sich los, bleibt neben mir stehen, stützt die Hände in die Taille und keift wie ein Fischweib. »Wann hätte ich das denn tun sollen? Die Kakaodose war immer in Ihrem Besitz. Wenn hier jemand reingelegt wurde, dann ich! Sie haben das Gold vor mir versteckt!«
»Du hast doch den Staub gesehen, und du warst immer in meiner Nähe, ich bin doch kein Zauberkünstler.« Der Zorn hat mich ins »du« fallen lassen, was eine ungewollte Nähe schafft, die ich sofort wieder beenden muss. »Wenn Sie es nicht waren, wer war es dann?«
Noria setzt sich neben mich an das Feuer und schweigt, aber ich sehe, dass es in ihr arbeitet. Endlich nimmt sie auch einen Becher Suppe und trinkt ihn aus.
»Vielleicht weiß ich, was geschehen ist.«
»Und was wäre das?«
»Ich bin jetzt sehr müde und muss noch eine Weile dar über nachdenken.« Sie gähnt und streckt sich auf ihrer Matte aus, und ich überlege, ob ich es aus ihr herausprügeln soll.
Aber dann wird mir klar, dass das ein Fehler wäre. Mit Gold wäre ich ohne sie durchgekommen, aber ohne Gold ist sie meine einzige Trumpfkarte.
Mein Blick fällt wieder auf die Blechdose und entzündet meinen Zorn. Jemand hat mich reingelegt, und dieser Jemand wird dafür büßen. Vorsichtshalber warte ich noch, bis Noria fest schläft, dann durchsuche ich ihre wenigen Sachen, aber sie sind sauber.
Anschließend lege ich mich auch zu einem Nickerchen hin, der Marsch und diese unerwartete Enttäuschung haben alle Energie aus meinen Knochen gezogen.
Als ich am späten Nachmittag wieder aufwache, ist Noria verschwunden und mit ihr meine Ausrüstung, mein Messer, mein Gewehr und sogar die elende rostige Blechdose, nur der Steinhaufen ist noch da. Es fällt mir schwer, ruhig zu bleiben, ich trete gegen den Steinhaufen, pfeffere die Steinklumpen ins Wasser und verschaffe meinem Unmut Luft, indem ich gegen alles schlage, was mir in die Quere kommt, und erst der Gedanke daran, dass sie dank meines Briefes an Ranavalona nicht lange Freude an dem Gold haben
Weitere Kostenlose Bücher