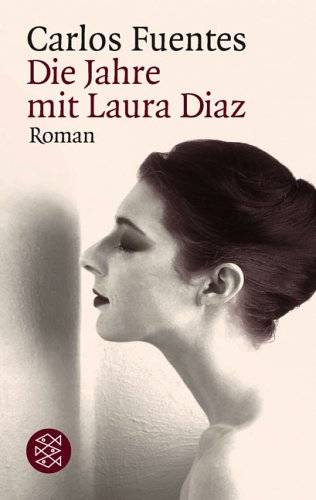![Die Jahre mit Laura Diaz]()
Die Jahre mit Laura Diaz
gestreifter Tracht und mit dem Davidstern an der Brust zu erkennen, sie hüllten sich in Decken, die von der Februarkälte durchdrungen wurden, und sie hielten sich umschlungen. Nur sie nicht.
Wenn sie uns erlaubten, das zu sehen, was würde es dann jenseits des Sichtbaren geben, was verbargen sie vor uns, merkten sie nicht, wenn sie uns ihr bestes Gesicht vorführten, daß sie uns zwangen, uns Gedanken über das wirkliche Gesicht zu machen, das verborgene Gesicht? Wenn sie uns dieses schreckliche Gesicht als ihr bestes zeigten, wollten sie uns dann nicht sagen, daß es das schlimmste gar nicht gab – nicht mehr? War dies das Gesicht des Todes?
Ich sah Raquel.
Sie wurde von einem Uniformierten gestützt, einem Nazi-sachter, der ihr half, ich weiß nicht, ob man ihm befohlen hatte, Mitgefühl zu zeigen, indem er eine hilflose Person stützte. Ich weiß nicht, ob es deshalb geschah, damit Raquel nicht wie ein Lumpenhaufen zusammenbrach, weiß nicht, ob es zwischen den beiden, Raquel und dem Wächter, eine hingebungsvolle, dankbare Beziehung mit winzigen Gefälligkeiten gab, die ihr ungeheuer groß vorkommen mußten, eine Extraportion, eine Nacht im Bett des Feindes, vielleicht auch ein bloßes, menschliches Quantum Mitgefühl, vielleicht Theater, eine Pantomime der Menschlichkeit, um die Besucher zu beeindrucken – oder vielleicht eine neue, unvorhersehbare Liebe zwischen Opfer und Henker, die beide Schaden erlitten hatten und nur imstande waren, den Schaden zu ertragen, wenn sie sich in einer unerwarteten Gemeinschaft zusammenschlössen, wobei sich der Henker durch seinen qualvollen Gehorsam mit dem Opfer und dessen qualvollem Gehorsam identifizierte: beide gehorsame Menschen, jeder gehorchte den Befehlen eines Stärkeren. Hitler hatte es gesagt, Raquel hatte es mir wiederholt: Nur zwei Völker stehen einander gegenüber, die Deutschen und die Juden.
Vielleicht sagte sie mir gerade: Siehst du, warum ich in Havanna nicht mit dir das Schiff verlassen habe? Ich wollte, daß mit mir geschah, was jetzt geschieht. Ich wollte mich meinem Schicksal nicht entziehen.
Da riß sich Raquel vom Arm des Naziwächters los und packte den Stacheldrahtzaun, stand zwischen ihrem Henker oder Liebhaber oder Beschützer oder Komödianten und mir, Jorge Maura, ihrem jungen Geliebten von der Universität, mit dem sie eines Tages das Freiburger Münster betreten hatte, und wir beide knieten damals Seite an Seite, ohne die Angst, uns lächerlich zu machen, und beteten laut:
»Wir werden zu uns selbst zurückkehren, wir werden so denken, als gründeten wir eine Welt, wir werden lebendige Subjekte der Geschichte sein, wir werden die Welt des Lebens erleben.«
Jene Worte, die wir damals in tiefer geistiger Erregung sagten, kommen nun wieder, Laura, als erdrückende Wirklichkeit und unerträgliche Tatsache, nicht etwa, weil sie sich verwirklicht hätten, sondern gerade deshalb, weil sie nicht möglich wurden, der Schrecken der Zeit verbannte sie, doch auf eine geheimnisvolle und wunderbare Weise machte er sie auch möglich, sie waren die abschließende Wahrheit meiner flüchtigen, schrecklichen Begegnung mit einer Frau, die ich liebte und die mich liebte…
Raquel drückte die Hände in den Draht, riß sie dann von den Eisenstacheln des Zauns los und zeigte sie mir, sie bluteten wie… Ich weiß nicht, wie, weil ich es nicht weiß und auch nicht wissen will, ich will die schönen Hände Raquel Mendes-Alemâns mit nichts anderem vergleichen, diese Hände, die dazu geschaffen waren, meinen Körper so zu berühren, wie sie die Seiten eines Buchs berührte, wie sie die Tasten bei einem Impromptu Schuberts berührte, wie sie meinen Arm berührte, um sich zu wärmen, wenn wir im Winter zusammen durch die Straßen Freiburgs liefen: Jetzt bluteten ihre Hände wie die Wundmale Christi, und das zeigte sie mir: Sie mir nicht ins Gesicht, sieh meine Hände an, bedaure meinen Körper nicht, hab Mitleid mit meinen Händen, Georg, hab Erbarmen, Freund… Danke für mein Schicksal. Danke für Havanna.
Der Nazikommandant, der uns begleitete und der seine Beunruhigung und seinen Ärger über Raquels Tat hinter einem Lächeln verbarg, sagte leichthin: »Sie sehen ja, das Märchen stimmt nicht, daß der Stacheldraht in Buchenwald unter Strom steht.«
»Verbinden Sie ihr die Hände. Sehen Sie doch, wie sie bluten, Herr Kommandant.«
»Sie hat den Draht angefaßt, weil sie das wollte.«
»Weil sie frei ist?«
»So ist es. So ist es. Sie sagen
Weitere Kostenlose Bücher