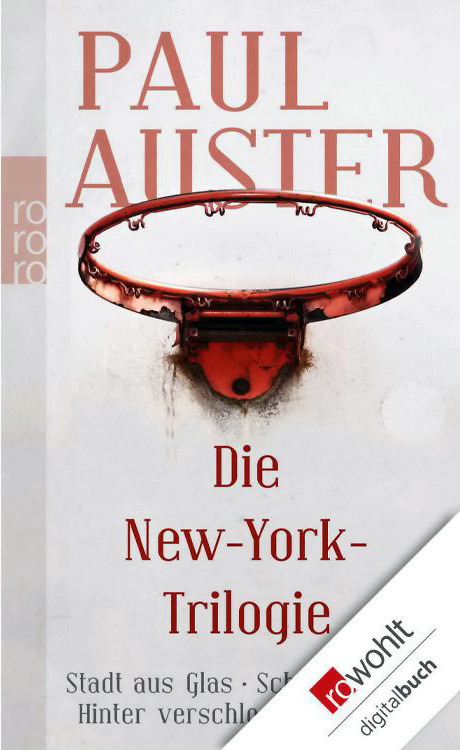![Die New-York-Trilogie: Stadt aus Glas. Schlagschatten. Hinter verschlossenen Türen]()
Die New-York-Trilogie: Stadt aus Glas. Schlagschatten. Hinter verschlossenen Türen
einziges Mal berührt er den Grund von Blues Qualen und Ängsten. Blue sieht sich von dem Mann verraten, der einmal wie ein Vater zu ihm war, und als er den Brief zu Ende gelesen hat, fühlt er sich leer und völlig aus der Fassung gebracht. Ich bin auf mich allein gestellt, denkt er, es gibt niemanden mehr, an den ich mich wenden kann. Mehrere Stunden lang verfällt er in Mutlosigkeit und Selbstmitleid und denkt ein- oder zweimal, dass es besser wäre, tot zu sein. Aber schließlich überwindet er seine düstere Stimmung. Denn Blue ist eigentlich ein ausgeglichener Mensch und neigt weniger zu finsteren Gedanken als die meisten, und wer sind wir, dass wir ihm Vorwürfe machen dürften, wenn ihn manchmal der Weltschmerz überkommt? Als es Zeit fürs Abendessen wird, hat er sogar schon angefangen, die guten Seiten zu sehen. Das ist vielleicht sein größtes Talent: nicht dass er nicht verzweifelt, sondern dass er nie sehr lange verzweifelt ist. Letzten Endes ist es vielleicht in Ordnung so, sagt er sich. Es ist vielleicht besser, allein zu sein, als von einem anderen abzuhängen. Blue denkt eine Weile darüber nach und entscheidet, dass es einiges für sich hat. Er ist kein Lehrling mehr. Es gibt keinen Meister mehr über ihm. Ich bin mein eigener Herr, sagt er sich. Ich bin mein eigener Herr und schulde niemandem Rechenschaft außer mir selbst.
Angeregt und erfüllt von dieser neuen Erkenntnis, stellt er fest, dass er endlich den Mut hat, mit der zukünftigen Mrs. Blue Verbindung aufzunehmen. Als er aber den Hörer abhebt und ihre Nummer wählt, meldet sich niemand. Er ist enttäuscht, aber bleibt ungerührt. Ich werde es ein andermal wieder versuchen, sagt er. Bald einmal.
Und weiter vergehen die Tage. Wieder nimmt er mit Black den gleichen Schritt auf, vielleicht noch harmonischer als zuvor. Dabei entdeckt er das Paradoxe der Situation. Denn je näher er sich Black fühlt, desto weniger hält er es für nötig, an ihn zu denken. Mit anderen Worten, je tiefer er sich verstrickt, umso freier ist er. Was ihn bedrückt, ist nicht Teilnahme, sondern Trennung. Denn nur wenn Black sich von ihm zu lösen scheint, muss er ausgehen und ihn suchen, und das kostet Zeit und Mühe, um nicht zu sagen Kampf. In den Phasen jedoch, in denen er sich Black ganz nah fühlt, kann er beginnen, so etwas wie ein unabhängiges Leben zu führen. Zuerst ist das, was er sich gestattet, nicht sehr gewagt, aber trotzdem betrachtet er es als eine Art Triumph, beinahe als einen Akt der Tapferkeit. Zum Beispiel das Haus zu verlassen und den Block auf und ab zu gehen. So klein sie sein mag, erfüllt ihn diese Geste doch mit Glück, und während er in dem schönen Frühlingswetter in der Orange Street hin und her geht, ist er auf eine Weise, die er seit Jahren nicht mehr empfunden hat, froh, am Leben zu sein. Von dem einen Ende aus hat man einen Blick auf den Fluss, den Hafen, die Silhouette von Manhattan, die Brücken. Blue findet das alles schön, und an manchen Tagen erlaubt er sich sogar, einige Minuten auf einer der Bänke zu sitzen und auf die Boote hinauszuschauen. Am anderen Ende steht die Kirche, und manchmal geht Blue zu dem kleinen grasbewachsenen Friedhof, um dort eine Weile zu sitzen und die Bronzestatue Henry Ward Beechers zu betrachten. Zwei Sklaven halten Beechers Beine umklammert, als wollten sie ihn bitten, ihnen zu helfen, sie endlich zu befreien, und in die Ziegelmauer dahinter ist ein Porzellanrelief Abraham Lincolns eingelassen. Blue kann nicht umhin, sich durch diese Bilder angesprochen zu fühlen, und jedes Mal, wenn er zu dem Friedhof kommt, füllt sich sein Kopf mit edlen Gedanken über die Würde des Menschen.
Nach und nach wird er verwegener und entfernt sich weiter von Black. Es ist 1947, das Jahr, in dem Jackie Robinson zu den Dodgers kommt, und Blue verfolgt seinen Fortschritt, er denkt an den Friedhof und weiß, dass es um mehr geht als nur um Baseball. An einem hellen Dienstagnachmittag im Mai beschließt er, einen Ausflug nach Ebbetts Field zu machen, und als er Black in seinem Zimmer in der Orange Street zurücklässt, wie üblich mit Feder und Papieren über seinen Tisch gebeugt, fühlt er keinen Grund zur Sorge; er ist sich sicher, dass alles noch genau so sein wird, wenn er zurückkommt. Er fährt mit der U-Bahn, mischt sich unter die Menge, gibt sich ganz dem Gefühl des Augenblicks hin. Als er im Stadion seinen Platz einnimmt, fallen ihm die klaren Farben um ihn herum auf: das grüne Gras, die braune Erde,
Weitere Kostenlose Bücher