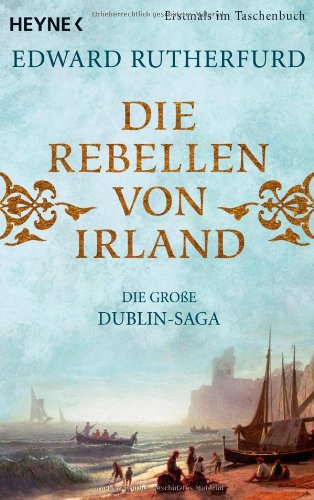![Die Rebellen von Irland]()
Die Rebellen von Irland
die friedliche Armee O’Connells militant wurde, so war das weiß Gott verständlich. Doch wenn er sah, wie eine Phalanx von Priestern mit Spielleuten und wehenden Fahnen vor ihren Männern hermarschierte, meinte er eine Selbstgefälligkeit zu spüren, die ihm Unbehagen bereitete.
Vielleicht lag es am Alter, aber je älter er wurde, desto größer wurde seine Achtung vor dem Kompromiss. Aus seiner Sicht gingen diese Priester hier weiter als nötig. Gewiss, Reformen waren unumgänglich, aber zu Feindseligkeit bestand kein Grund. Mittlerweile unterhielt die britische Regierung zum Vatikan recht freundliche Beziehungen. In den Jahren, in denen Napoleon Europa beherrschte und die katholischen Monarchen bedrohte, war Rom froh gewesen, dass England ein Bollwerk gegen ihn gebildet hatte. Und als zwölf Jahre zuvor, nach Napoleons endgültiger Niederlage, auf dem Wiener Kongress Europa territorial neu geordnet wurde, waren es die Briten gewesen, die darauf bestanden, dass der reiche italienische Kirchenstaat an den Papst zurückfiel, wofür dieser den Briten bis heute dankbar war. O’Connell und die Gemeindepriester hatten zwar völlig Recht, wenn sie den Zehnten anprangerten, aber ihre Empörung über den Einspruch des Premierministers gegen die Ernennung von Bischöfen war unangebracht. Wie William aus zuverlässiger Quelle wusste, verständigten sich die britische Regierung und der Vatikan über die Besetzung der wichtigsten Kirchenämter zur beiderseitigen Zufriedenheit diskret hinter den Kulissen.
»Ich bin wie O’Connell für die Gleichstellung der Katholiken«, sagte er zu Tidy. »Und da ich nie für die Union war, würde ich auch die von ihm geforderte Aufhebung der Union unterstützen. Aber die Zeiten ändern sich, und man muss sehen, was praktikabel ist. Diese Militanz ist gefährlich.«
William Mountwalsh verbrachte gewöhnlich drei Monate im Jahr in London. Er genoss es, im britischen Oberhaus zu sitzen und sich über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden zu halten. Außerdem konnte man dort viel bewirken. Selbst Henry Grattan war dieser Meinung gewesen, denn er hatte die letzten fünfzehn Jahre seines Lebens im Londoner Parlament zugebracht. Und trotz der Angst vor dem Katholizismus, die in der englischen Volksseele tief verankert war, wie er mittlerweile begriff, gab es im britischen Parlament und insbesondere unter den liberalen Whigs viele, die ehrlich bemüht waren, die Forderungen der irischen Katholiken zu erfüllen. Erst in diesem Frühjahr waren die Dissenter von den letzten rechtlichen Benachteiligungen befreit worden. Auf Dauer war es unvermeidlich, dass die Katholiken ähnlich behandelt wurden. Geduld war gefragt.
Doch was er hier sah, war Krieg. Ein Krieg zwischen Pächtern und Grundherren, ein Krieg zwischen Katholiken und Protestanten.
»Außerdem befürchte ich«, fügte Samuel Tidy jetzt hinzu, »dass das bei den Presbyterianern und Orangeisten die schlimmsten Befürchtungen wecken wird.«
»Wie Recht Sie haben«, pflichtete William bei. Seit seiner Jugendzeit hatten die Presbyterianer ihre Haltung völlig geändert. Damals strebten die meisten Presbyterianer in Ulster noch nach Unabhängigkeit von England und seiner Kirche, die sie zu Bürgern zweiter Klasse stempelten. Heute jedoch, da ihre Rechte gesichert waren, traten sie entschieden für die Union ein. »Vereint mit England und Schottland sind wir Teil der protestantischen Mehrheit«, erklärten sie. »Ohne England werden wir zu einer Minderheit in einem Meer irischer Papisten.« Und getrieben von dieser Angst schlugen ihre Prediger ähnlich scharfe Töne an wie in den Tagen Cromwells. Als sie vom Marsch der Priester und Pächter in Clare lasen, wurden ihre schlimmsten Befürchtungen wach.
Und plötzlich musste William Mountwalsh voller Wehmut an die Tage seiner Jugend denken. Er sehnte sich nach den alten Patrioten oder den Männern von ’98, Männern wie Patrick Walsh oder den vortrefflichen jungen Robert Emmet. Sie alle hatte eine gemeinsame Vision verbunden, der Traum von einem freien Irland, in dem Katholiken und Protestanten, Presbyterianer und Deisten gleichberechtigt leben konnten. Es mochte idealistisch gewesen sein, aber es war ein hehres Ideal, und so etwas vermisste er heute.
***
Samuel Tidy stellte in diesem Augenblick ganz andere Überlegungen an. Er war zum ersten Mal im Westen. Er kannte Dublin und Leinster mit seinem fruchtbaren Ackerland oder die betriebsame Hafenstadt Cork. Er kannte Ulster mit seinen
Weitere Kostenlose Bücher