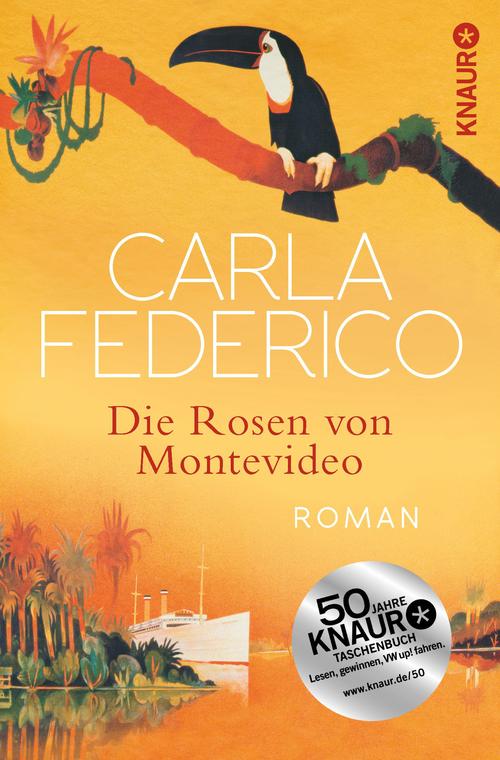![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
über den Krieg mitbekommen hatte: Demnach hasste Francisco Solano Lopez die Brasilianer, wie Alejandro mehrmals schreiend verkündet hatte, weswegen er die dortigen Negersklaven aufgerufen hatte, für ihn in den Krieg zu ziehen. Allerdings ging auch das Gerücht um, dass Lopez nicht nur die Brasilianer, sondern auch die Neger selbst hasste und sie massakrieren ließ, wenn sie keinen Nutzen mehr erfüllten.
Ob dieser Schwarze das wusste? Und ob sie darum vielleicht bei ihm auf Gnade hoffen konnte?
Allerdings, selbst wenn dieser nicht auf Lopez’ Seite stand – es hieß, dass die Uruguayer und Brasilianer sich noch mehr hassten und nur der Zufall die alten Feinde zu Verbündeten gemacht hatte.
Nicht weit von dem Schwarzen entfernt hockte eine andere furchterregende Erscheinung. Auch die Haut von diesem Mann war dunkel, wenngleich nicht ins Schwarze gehend, und sein Gesicht mutete fremdländisch an, nicht zuletzt aufgrund des Lippenpflocks, den er trug, und wegen der Vogelflügel, die von seinen Ohrläppchen baumelten. Valeria erschauderte. Wahrscheinlich war er ein Indianer Paraguays, ein Payaguá. Von diesen hatte sie nicht nur aus Alejandros Mund, sondern einst auch von Espe gehört. Obwohl diese selbst von Indianern abstammte, hatte sie schaurige Geschichten von den Payaguás erzählt, so, dass es keinen Menschenschlag auf Erden gab, der so viel Schmerz ertragen konnte wie diese – und dass sie zugleich für ihre Folterungen bekannt waren. Alejandro hatte behauptet, dass sie besonders treu zum Diktator standen, und Julio wiederum hatte während eines Abendessens, da er sich selbst am Rinderbraten labte, angewidert erzählt, dass sie sich vorzugsweise vom Fleisch der Krokodile ernährten.
Pablo nannte ihn Pinon, doch als er mit ihm redete, verstand Valeria kein Wort. Wahrscheinlich sprachen sie nicht Spanisch, sondern Guaraní, die Sprache der Indianer – und die beherrschte sie nicht. Nun, sie wollte ohnehin nicht mit ihm reden, denn von ihm war Mitleid wohl am wenigsten zu erwarten.
Dann waren da noch drei weitere Männer, hellhäutiger diese und Paraguayer vom Schlage Valentíns und Pablos. Sie hießen, wie sie im Laufe ihres kargen Mahls herausfand, Ruben, Pío und Jorge. An ihren Gürteln hingen nicht nur gestohlene Waffen, sondern noch mehr Beute – wahrscheinlich hatten sie diese im Krieg toten Soldaten abgenommen: Messer mit kunstvoll geschnitzten Griffen, Taschenuhren, die in der Sonne glänzten, und klapperndes Kochgeschirr. Sie warfen ihr verstohlene Blicke zu, die man bestenfalls für neugierig halten konnte, schlimmstenfalls für anzüglich, und die ganz sicher nicht freundlich gemeint waren.
Das waren wohl Männer, über die ihr Großvater behauptete, dass sie mit dem Schlachtruf »Quiero morir« in den Krieg zogen: Ich will sterben. Sie kannten keinen Mittelweg zwischen Siegen und Untergehen, und auf die Aufforderung, sich zu unterwerfen, antworteten sie ohne Umschweife: Dazu habe ich keinen Befehl.
Von diesen drei hatte sie gewiss ebenso wenig Hilfe zu erwarten wie von dem Schwarzen oder dem Indianer. Sie blickte wieder auf das Bruderpaar. Beim Essen hatten sie noch einträchtig beisammengesessen, nun stritten sie erneut miteinander, wenngleich nur flüsternd und auf das Feuer starrend.
»Du willst sie doch nicht ernsthaft nach Paraguay mitnehmen«, sagte Valentín eben kopfschüttelnd.
»Verstehst du nicht – wir müssen jede Möglichkeit nutzen, den Krieg zu unseren Gunsten zu wenden!«, hielt Pablo ihm trotzig entgegen. »Wir brauchen Waffen!«
»Sie ist eine Frau – und Krieg ist Männersache.«
»Wie viele Frauen wurden von der Allianz abgeschlachtet? Und wer wüsste das besser als wir?«
Düsternis senkte sich über Valentíns Züge. »Aber denkst du nicht …«, setzte er dennoch an.
»Kein Wort mehr«, unterbrach Pablo ihn harsch. »Ich bin der Älteste und nach dem Tod unseres Vaters das Oberhaupt der Familie. Ich entscheide, dass wir sie mitnehmen. Wir werden nach Asunción zurückkehren und von dort aus Kontakt zu den de la Vegas’ aufnehmen. Es mag schwer werden, aber ich finde einen Weg – in unserem Land gibt es genügend Schmuggler, die wir für diesen Zweck einspannen können. Und keiner unserer Heerführer wird etwas dagegen haben, dass wir ihn regelmäßig mit Waffen beliefern, und auch wenn wir sie billig anbieten, verdienen wir ein nettes Sümmchen. Ja, so wird’s gemacht. Wenn du etwas dagegen hast, kannst du gehen.«
Valeria sah, wie es hinter
Weitere Kostenlose Bücher