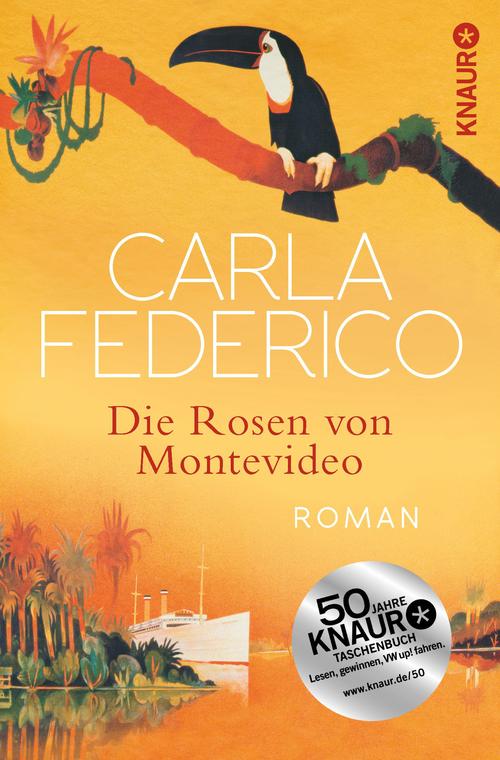![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
sie stürmte hastig hinaus.
Sie hoffte, José einzuholen, fand ihn jedoch nicht mehr im Haus und lief verzweifelt zum Stall. Gott sei Dank traf sie ihn dort, wo sie ihn vermutet hatte – bei Diablo. Er strich dem Tier ein letztes Mal über den Kopf, dabei war sein Blick unendlich wehmütig. Kurz befremdete es sie, dass er offensichtlicheren Schmerz zeigte als vorhin, da er damit hatte rechnen müssen, sie zum letzten Mal zu sehen, aber dann sagte sie sich, dass er sich in Julios und Leonoras Gegenwart schließlich hatte beherrschen müssen – genauso wie sie.
Jetzt zitterte ihre Stimme, als sie seinen Namen rief.
Er fuhr herum, und sein Gesicht wurde wieder ausdruckslos.
»Du solltest nicht hier sein.«
»Es tut mir leid, es tut mir alles so leid!«, stammelte sie.
Er senkte seinen Blick. »Ich hätte es besser wissen müssen.«
Er bückte sich, ergriff das Bündel mit seinen Habseligkeiten und ging an ihr vorbei.
»José!« Sie lief ihm nach. »Du … du kannst doch nicht einfach gehen. Du …«
»Du hast deinen Onkel doch gehört.« Immerhin blieb er stehen.
Sie packte seine Hände. »Ich werde mir etwas einfallen lassen. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder eine Stelle bekommst. Ich … ich liebe dich doch.«
Sie hoffte, dass er ihr leidenschaftliches Bekenntnis erwiderte, dass er sie küsste. Beides blieb aus. Zumindest nahm er ihre Hände und drückte sie kurz.
»Du bist ein liebes Mädchen, aber vor allem bist du eine de la Vegas.«
»Nein!«, protestierte sie. »Ich bin eine Gothmann. Ich werde mir unser Glück nicht ruinieren lassen.«
Er starrte sie nachdenklich an. »Vielleicht bleibe ich noch eine Weile in Montevideo.«
Er sagte nicht ausdrücklich, dass sie sich bald wiedersehen würden, aber sie hoffte, dass er es so meinte.
»Es wird alles gut, ich verspreche es dir«, rief sie.
Wortlos nickte er, ließ ihre Hände los und ging.
Sie stellte sich ihm kein zweites Mal in den Weg, sondern verbarg ihr Gesicht in den Händen. Wieder war ihr zum Weinen zumute, aber erneut schluckte sie trotzig ihre Tränen hinunter.
31. Kapitel
A ua!«, entfuhr es Carlota zum wiederholten Mal.
Sie hasste die Näharbeit. Ständig stach sie sich in den Finger, die Nähte gerieten ungerade, was zur Folge hatte, dass es ihr trotz aller Mühen doch nur Tadel einbrachte, und am schlimmsten war, dass sie nebenan meist ihre Eltern streiten hörte.
Was heute der genaue Anlass für ihre Auseinandersetzung war, wusste sie nicht, aber im Grunde ging es immer um dasselbe. Der Vater kam von der Arbeit heim und beklagte sich darüber. Die Mutter hörte eine Weile zu, wurde dann aber seiner Klagen überdrüssig und hielt ihm entgegen: »Ich und Carlota haben ebenfalls schwer zu schuften.«
»Ihr näht – ich hingegen schlachte Tiere. Das ist ein Unterschied!«
»Wärst du glücklich, wenn wir auch Tiere schlachten und den ganzen Tag in ihrem Blut waten müssten?«, fragte die Mutter dann bissig.
Ihr Vater arbeitete in einem der Saladeros, und Carlota, die ihn von dort schon häufig abgeholt hatte, wusste, was ihm so sehr zu schaffen machte, auch wenn er stets beteuerte, dankbar für die Arbeit dort zu sein. Schließlich war er über lange Jahre arbeitslos gewesen, ehe jene Betriebe wie Pilze aus dem Boden schossen und die Geschäftsführer händeringend nach kräftigen Männern suchten, ohne zu fragen, woher sie kamen und womit sie bisher ihr Brot verdient hatten. Es zählte nur, dass sie zupacken konnten und sich von den schrecklichen Bedingungen nicht abhalten ließen. Zu Beginn des Jahrhunderts war in jenen Saladeros nur in kleinen Mengen Trockenfleisch erzeugt worden: Man hatte ein paar Rinder geschlachtet, das Fleisch leicht gesalzen und an der Luft trocknen lassen und es nach Brasilien verkauft, wo die Sklaven davon lebten. Doch dann waren die Engländer in das Geschäft eingestiegen und hatten in Montevideo und Buenos Aires aus den bisherigen Familienbetrieben riesige Schlachthöfe gemacht, in denen täglich Dutzende von Tieren getötet, ausgeweidet und enthäutet wurden.
Bis jetzt hatte der Vater jede Stelle nach wenigen Monaten wieder verloren, weil er – wie ihre Mutter sagte – den Mund nicht halten konnte oder weil er – wie er selbst behauptete – Ungerechtigkeit nicht ertrug und nicht zusehen konnte, wie man einfache Leute ausbeutete, doch in den Saladeros sah man darüber hinweg, wenn er nur seine Arbeit machte, denn das war eine, um die sich wahrlich niemand riss. In der Luft hing
Weitere Kostenlose Bücher