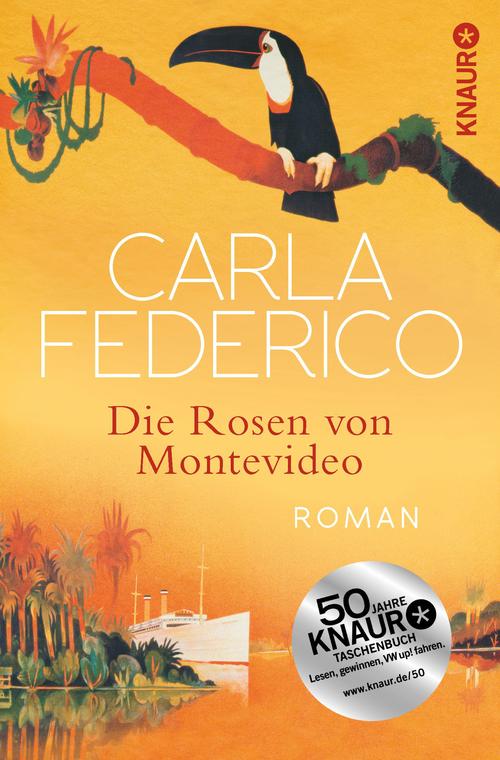![Die Rosen von Montevideo]()
Die Rosen von Montevideo
und habe nicht gemerkt, dass ich damit auch ihr geschadet habe. Es war fast, als ließe ich sie büßen, dass ich ihre Schwester aufgegeben habe. Und das ist ungerecht gewesen!«
»Mein Gott, warum hast du mir nie die Wahrheit gesagt? Wir hätten doch gemeinsam um dieses Kind trauern können.«
»Ich dachte, dein Leid wäre schon groß genug. Du hast für mich auf deine Heimat verzichtet und mit deinem Bruder gebrochen. Und ich dachte mir, du könntest mich verachten …« Immer mehr heiße Tränen strömten über ihr Gesicht.
»Nie im Leben!«, rief er empört. »Ich hätte alles ertragen, wenn du es nur mit mir geteilt hättest. Aber so hatte ich stets das Gefühl, ich allein wäre schuld an deinem Elend. Manchmal habe ich geahnt, dass du mir etwas verschweigst, aber ich dachte immer, es wäre Reue, dass du dich für mich und gegen deine Familie entschieden hast.«
»Ach Valentín …«, seufzte sie.
Er atmete heftig. »Nur aus diesem Grund habe auch ich dir so lange etwas verschwiegen, dass nämlich … dass nämlich …«
»Sag es! So sag es doch!«
Auch wenn sie ihn nicht sehen konnte, vermeinte sie zu fühlen, wie sein Kiefer mahlte.
»Vor einigen Jahren bin ich hier in Montevideo zufällig Tshepo über den Weg gelaufen«, brachte er schließlich mühsam hervor.
»Der Schwarze aus Brasilien, der zu den Gefolgsmännern deines Bruders zählte?«
»Genau, und er hat mir erzählt, dass …«
Wieder brach er ab, aber Valeria ahnte, was er sagen wollte. »Dass Pablo den Krieg nicht überlebt hat«, sagte sie leise. »Aber das hast du doch immer geahnt.«
»Geahnt, aber nicht gewusst! Vor allem nicht, wie er ums Leben kam.«
Er schwieg lange und schien mit den Dämonen seiner Vergangenheit ebenso zu ringen wie sie gerade mit den ihren.
»Eine Granate der Argentinier …«, sagte er schließlich, »im letzten Kriegsjahr, es ging ganz schnell … Eigentlich sollte ich froh sein, dass er nicht irgendwo verwundet auf dem Schlachtfeld liegen blieb und quälend langsam krepierte. Und dennoch …«
Sie legte ihre Hand auf seine Schulter und spürte, wie sie erzitterte.
»Und dennoch hast du um ihn getrauert«, murmelte sie. »Aber du hast nicht gewagt, mit mir zu reden, weil ich Pablo ebenso gefürchtet wie gehasst habe.«
»Ich weiß, was er dir angetan hat!«, rief Valentín. »Ich bin bis heute froh, dass ich mich von ihm losgesagt habe! Und dennoch … er … er war doch mein Bruder.«
Seine Stimme klang gepresst, und auch Valerias Kehle wurde plötzlich eng. Nicht wegen Pablo, sondern weil sie tief bereute, dass sie sich erst jetzt ihr Innerstes anvertrauten. Es tat unendlich gut, aber es kam spät … viel zu spät.
Unwillkürlich zog sie ihre Hand zurück. Was zwischen ihnen stand, ließ sich nicht durch wenige Worte aus der Welt räumen. Mit ihrer Trauer um die zweite Tochter und Valentíns Trauer um Pablo hätten sie leben können, doch das Schweigen, das sich wie ein schwarzer Schatten über sie legte, war unerträglich. Es hatte ihre Liebe, ihre Hoffnung, ihre Lebenslust erstickt – all die Jahre, selbst jetzt noch. Und nach ihrer beider Bekenntnisse erschien ihr die Blindheit plötzlich nicht länger als schlimmes Geschick, sondern als gerechte Strafe für sie beide: für ihn, weil er nie Fragen gestellt hatte, für sie, weil sie nicht hatten sehen wollen, wie es in seinem Innersten aussah.
Sie schluchzte auf und lief erneut davon. Valentín war so verdattert, dass er ihr nicht gleich folgte. Erst nach einer Weile hörte sie sein Rufen, doch sie blieb nicht stehen.
»Valeria, gib acht, Valeria, du …«
Plötzlich hörte sie ein lautes Rumpeln. Es kam von rechts, und sie duckte sich unwillkürlich.
Später erfuhr sie, dass sie an einem Fuhrwerk vorbeigelaufen war, sich die Fässer, die dieses transportierte, gelöst hatten, auf die Straße gerollt waren und sie mitten in sie hineinlief. In diesem Augenblick spürte sie nur, wie die Erde vibrierte, wie etwas Schweres auf sie donnerte, erst ihre Beine und Arme traf, dann gegen ihren Kopf prallte.
Die Schwärze, absoluter noch als jene, die sie seit Wochen begleitete, verschluckte sie ganz und gar. Sie fiel zu Boden, spürte jedoch keinen Schmerz. Da war nichts … nur großes, blankes Nichts.
Irgendwann tauchte in dem Nichts ein Licht auf. Noch war es nur ein Streifen, doch der wurde immer breiter. Sie sah den dunstigen Himmel, sah Hauswände, sah die Ochsen vor dem Fuhrwerk – und Valentíns Gesicht, als er sich besorgt
Weitere Kostenlose Bücher