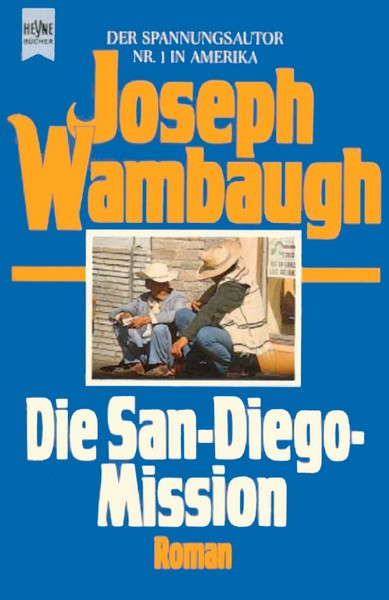![Die San-Diego-Mission]()
Die San-Diego-Mission
uniformierter Schichtführer zu arbeiten und das BARF-Geschäft Manny zu überlassen.
Manny Lopez hatte seine ganz bestimmte Meinung über amerikanische Cops mit mexikanischer Herkunft, und wenn er sie von sich gab, hörte es sich an wie auf einer Einsatzbesprechung. Er streckte den Finger aus wie eine Waffe: »Es gibt die Minoritäten, und es gibt die anderen Minoritäten«, predigte Manny. »Die schwarzen Cops sprechen mit einer Stimme. Damit können sie was erreichen. Die Mexikaner nicht. Wir sind wie die verdammten Araber, die dauernd Streit miteinander haben. Mexikaner sind immer draufgängerische Polizisten, ganz scharf darauf, den Weißen zu imponieren, aber weil Mexikaner normalerweise nicht gerade geborene Akademiker sind, können sie im schriftlichen Examen nie besonders gut sein. Und weil sie auf der anderen Seite nicht gerade die Redseligsten sind, bleiben sie meistens auch in der mündlichen Prüfung hängen. Sie sind dann frustriert. Sie müssen's schlucken, daß da viel eher ein weißer Bursche oder sogar 'n schwarzer Bursche Sergeant wird. Cop zu sein ist schon hart genug, aber ein mexikanischer Cop mit all diesen Problemen? Und wenn dann ein mexikanischer Cop wie ich zufällig auch noch ganz gut öffentlich sprechen kann? Das verzeiht dir nie einer! Und trotzdem war ich Boß von dieser ganzen verdammten mexikanischen Polizeiorganisation! Mexikaner sind die mißgünstigsten Arschlöcher auf der Welt, und damit muß ich mich in meiner Squad rumschlagen. Ich war schon mal so weit, daß ich kaum noch zum Dienst gehen wollte, nicht wegen der Gangster, sondern wegen dieser fiesen Blicke und dieser Meckerei über meine Publicity. Ich habe versucht, mit ihnen ins reine zu kommen. Ich habe schließlich diese verdammten Storys nicht selber geschrieben!«
Eines Tages kam Manny Lopez in seiner Freizeit zufällig an einem Verkehrsunfall vorbei und zog eine Frau aus einem brennenden Auto. Er kam wieder mal in die Zeitung. Er erschien zum Dienst wie Roberto Duran zu einem Meisterschaftskampf. Er fegte ins Zimmer, knallte die Zeitungen auf den Tisch und erklärte: »Okay, ihr Ärsche, wer will jetzt als erster behaupten, ich hätt ihm den Ruhm geklaut, WENN ICH IN MEINER VERDAMMTEN FREIZEIT IN MEINER VER-DAMMTEN GEGEND ALLEIN IN MEINER VERDAMM-TEN KARRE SITZE?«
Das Ganze erinnerte viele Leute mehr und mehr an den Film Der Schatz der Sierra Madre, in dem die Goldgräber noch dicke Freunde sind, als sie losziehen, und sich dann verdammt rasch wie die Klapperschlangen belauern. Und soweit war es hier im Grunde ja auch schon.
Wenn sie nachts in den Canyons waren, richtete Carlos Chacon es immer so ein, daß er hinter Joe Castillo ging, und außerdem mußte immer noch irgendeiner zwischen ihnen sein. Joe hatte einfach zu viele Kommentare darüber abgegeben, daß Carlos ihn angeschossen hatte und daß Carlos ruhig auch mal angeschossen werden sollte, um zu spüren, wie man sich dabei so fühlt. Und wenn er ein paar Drinks zuviel intus hatte, sagte er es auch zu Carlos selbst, und das war dann weiß Gott kein Spaß mehr.
Es lief schließlich tatsächlich auf die letzte Schatz-der-Sierra-Madre- Szene hinaus. Sie hatten langsam mehr Angst voreinander als vor den Gangstern.
Es gab keine Ehefrau mehr, die sich nicht dringend wünschte, daß ihr Mann kündigte. Es gab keine Ehe mehr, die nicht unter der Anspannung litt. Aber die Mehrzahl der Barfer war für das ungeschriebene Gesetz des machismo nur allzu empfänglich; wenn es brenzlig wurde, standen sie es mit Hilfe des besten Verbündeten durch, den ein junger Macho-Cop sich nur wünschen konnte, nämlich mit Saufen. Gelegentlich verliebte sich auch mal der eine oder andere für ein paar Wochen, aber vor allem wohl, um diese bekloppte Phase seines Lebens überhaupt durchstehen zu können.
Außerdem gab es unter den Schlachtenbummlerinnen, die den letzten Revolverhelden überallhin folgten, einige echte Perlen. Eine zum Beispiel, die sie »die Schlange« nannten, hatte schon ein anderes Police Department hinter sich. Sie war nach San Diego gekommen, weil sie sich da fettere Weidegründe versprechen konnte und sicherlich eine neue Schar von Cops kennenlernen würde. Sie war ungefähr dreißig und trug eine dieser schillernden und undurchsichtigen Brillen, die seit zwanzig Jahren nicht mehr in Mode waren, es sei denn bei den Mitwirkenden von Saturday Night Live. Die Brille rutschte ihr dauernd von der Nase, so daß sie einen immer über den Rand der Gläser anzugucken
Weitere Kostenlose Bücher