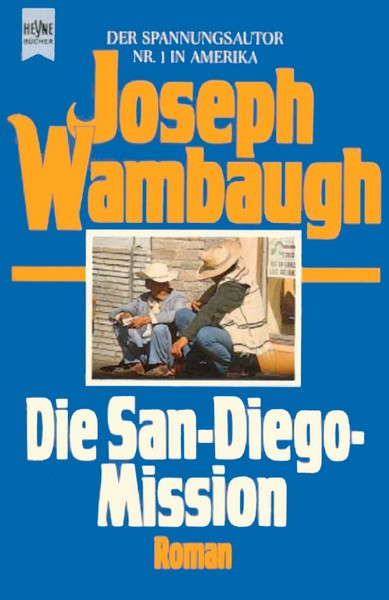![Die San-Diego-Mission]()
Die San-Diego-Mission
losmarschiert, um zu zeigen: Da sind wir!
So sinnlos der Krieg grundsätzlich sein mochte, irgendwie war er zumindest nicht ganz so sinnlos wie diese Jagd auf bewaffnete Männer im Stockfinsteren, dieses ständige bloße Reagieren anstelle von Agieren. Ernie Salgado äußerte sich eines Tages dahingehend, daß es die fast intime Nähe war, die hier draußen alles so schwierig machte. In Vietnam hatten sie ihre Feinde nie gesehen, es sei denn beim Zählen der Leichen. Bloß ein einziges Mal in dreizehn Monaten hatte Ernie einem Gegner Auge in Auge gegenübergestanden. Seine Truppe hatte im nächtlichen Dschungel gesessen und auf den Abmarsch gewartet, als zwei Vietkongs beinahe über sie gestolpert wären. Die beiden Vietkongs waren schon bis auf wenige Meter herangekommen, bevor sie von zehn Marinesoldaten in Stücke geschossen wurden. Das waren lebendige Menschen gewesen, denen man Auge in Auge gegenübergestanden hatte. Da ging's nicht um Bewegungen, um Konturen, um Mündungsfeuer, sondern um Menschen, die mit russischen Sturmgewehren bewaffnet waren, um ebenso junge Männer wie sie selbst. Und so war's wirklich ganz anders gewesen als jetzt in den Canyons.
In den folgenden Monaten äußerten sich einige andere Barfer, die nicht in Vietnam gewesen waren und deshalb über keinerlei Vergleichsmöglichkeiten verfügten, ähnlich. Und wenn man ihren Versuchen, ihre Gefühle zu beschreiben, aufmerksam genug zuhörte, kriegte man schließlich mit, daß sie meinten, hier draußen müsse man nicht mehr nur mit einer quasi normalen Angst fertig werden, sondern es komme eine andere Dimension hinzu: das Entsetzen. Wenn man auf eine Weise wie sie immer damit rechnen muß, einem gewaltsamen Tod zu begegnen, ist die normale Angst wohl kaum ohne jene schreckliche andere Dimension vorstellbar: nicht ohne die Urangst, die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, die sich zwangsläufig einstellt, sobald man Auge in Auge einem anderen Menschen gegenübersteht, der einen mit furchtbarer Vorsätzlichkeit vernichten will. Es ging hier um das Grauen und das archetypische Entsetzen, das man empfindet, wenn man ermordet werden soll.
Am Nachmittag des 23. März wollte Fred Gil wie gewöhnlich zur Arbeit gehen. Was bedeutete, daß er, bevor er zur Police Station fuhr, das Haus aufgeräumt und für seine Frau und Familie das Abendessen gekocht hatte. Und daß das tägliche Pensum an bitterbösen Streitgesprächen wieder mal erledigt worden war, nachdem seine Frau Jan das Haus betreten hatte. Sie wollten es nur noch so lange durchstehen, bis ihre Kinder alt genug wären, um die Scheidung ihrer Eltern verkraften zu können; ein Fehler, der offensichtlich in vielen Copfamilien gemacht wird.
Jan Gil war drei Jahre älter als Fred und in allem sein genauer Gegensatz. Sie wirkte größer, als sie in Wirklichkeit war, und hatte rotbraunes Haar, haselnußbraune Augen und ein längliches Gesicht. Der eine oder andere Barfer stellte gelegentlich fest, daß sie der Schauspielerin Lily Tomlin ähnlich sähe, während Fred irgendwie an den bekannten Golfer Lee Trevino erinnere. Insofern nannte man sie manchmal das Prominenten-Paar.
Dafür mußten sie ständig mit einer Tonne an Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen, die auf ihnen lastete, fertigwerden. Es gab ernste emotionale Probleme wegen Jans Tochter, die Fred adoptiert hatte. Sie waren ein ständiger Anlaß für neue Auseinandersetzungen. Außerdem hielt sie das Haus nicht so in Ordnung, wie es seinen Vorstellungen entsprach, so daß am Ende er den Haushalt machte und kochte, bevor er am Abend zum Dienst ging. Eine Anzahl von kleineren Problemen, die dennoch ebenfalls unerträglich wurden, machten das Dilemma immer schlimmer. Sie trank recht heftig, rauchte viel, feierte gern und konnte fluchen wie ein Bierkutscher. Alles das störte ihn gewaltig. Sie war aushäusig veranlagt, und er saß am liebsten zu Hause.
Sie konnte jedem Menschen gerade in die Augen schauen. Er vermied immer noch jeglichen Augenkontakt, wenn sich's ermöglichen ließ. Obgleich es kaum je ein Paar gegeben haben dürfte, das so schlecht wie sie zusammenpaßte, flehten die Kinder sie an, zusammenzubleiben.
»Er hatte sich geändert«, erinnerte sich Jan Gil. »Ehe er zu BARF ging, war er immer ein sehr weicher Typ. Er war unsicher, weil er sich den meisten Leuten unterlegen fühlte, und im Grunde sehr weich. Ich mein damit nicht, daß er ein Waschlappen war. Ich meine wirklich weich. Er hätte wohl am liebsten dauernd
Weitere Kostenlose Bücher