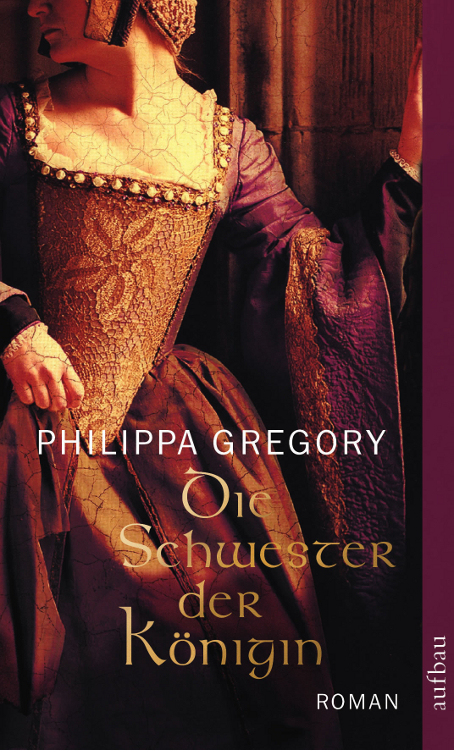![Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin]()
Die Schwester der Königin - Gregory, P: Schwester der Königin
könntet es zumindest lieben. Während Eure Familie so auf Anne fixiert ist und ihre Zukunft so ungewiß ist, könntet Ihr Euer eigenes Leben aufbauen, Eure eigene Wahl treffen. Im Augenblick haben sie Euch beinahe vergessen. Ihr könntet beinahe frei sein.«
Ich wandte ihm meine ganze Aufmerksamkeit zu. »Seid Ihr deswegen unverheiratet? Damit Ihr frei sein könnt?«
Er lächelte mich an, und seine Zähne blitzten in seinem |355| braunen Gesicht weiß auf. »O ja,«, erwiderte er. »Ich schulde keinem Mann Dank für meinen Lebensunterhalt, ich stehe bei keiner Frau in der Pflicht. Ich bin ein Mann Eures Onkels, trage seine Livree, aber ich verstehe mich nicht als sein Leibeigener. Ich bin einer freier Engländer und gehe meinen eigenen Weg.«
»Ihr seid ein Mann«, antwortete ich ihm. »Für eine Frau ist es etwas anderes.«
»Ja«, stimmte er mir zu. »Es sei denn, sie heiratet mich. Dann könnten wir zusammen unseren eigenen Weg gehen.«
Ich lachte leise und drückte den kleinen Henry ein wenig fester an mich. »Ihr würdet Euren eigenen Weg mit schrecklich wenig Geld gehen müssen, wenn Ihr durch Eure Heirat Euren Herrn verärgert und auch den Segen Eurer Eltern nicht habt.«
Stafford ließ sich nicht beirren. »Es gibt schlimmere Anfänge. Ich glaube, ich hätte lieber eine Frau, die mich liebt und die sich auf das Wagnis einläßt, daß ich für sie sorgen kann, als mich von ihrem Vater mit einer Mitgift und einem Ehevertrag fesseln zu lassen.«
»Und was würde sie bekommen?«
Er blickte mir in die Augen. »Meine Liebe.«
»Und dafür lohnt sich der Bruch mit Eurer Familie? Mit Eurem Herrn? Mit der Verwandtschaft?«
Er blickte auf die Türme der Burg. »Ich würde mir eine Frau wünschen, die frei ist wie ein Vogel, die mich aus Liebe will und sich sonst um nichts kümmert.«
»Dann hättet Ihr eine Närrin zur Frau«, erwiderte ich in scharfem Ton.
Er wandte sich zu mir um und lächelte. »Also ist es nur gut, daß mir noch keine Frau begegnet ist, die ich wollte«, antwortete er. »Sonst gäbe es wahrhaftig zwei Narren.«
Ich nickte. Mir schien, daß ich zwar aus diesem Wortwechsel siegreich hervorgegangen war, daß er aber längst noch nicht entschieden war. »Ich hoffe, eine Weile unverheiratet zu bleiben«, fügte ich vage hinzu.
»Das hoffe ich auch«, erwiderte er seltsamerweise. »Ich sage |356| Euch Lebewohl, Lady Carey.« Er verneigte sich und wollte gehen. »Und ich denke, Ihr werdet feststellen, daß Euer Junge noch immer Euer kleiner Bub ist, ob er nun lange Hosen oder kurze Hemdchen trägt«, meinte er sanft. »Ich habe meine Mutter bis zum Tag ihres Todes geliebt, Gott segne sie, und ich bin immer ihr kleiner Junge geblieben.«
Ich hätte mich über den Verlust von Henrys Locken wirklich nicht zu grämen brauchen. Nun konnte man nämlich die herrliche Rundung seines Kopfes und seinen zarten Hals viel besser sehen. In seinen Erwachsenenkleidern sah er nicht mehr wie ein Kleinkind aus, sondern vom Scheitel bis zur Sohle wie ein Prinz. Unwillkürlich begann ich darüber nachzudenken, daß er vielleicht tatsächlich eines Tages auf dem englischen Thron sitzen mochte. Er war der Sohn des Königs. Die Frau, die sehr wohl einmal die englische Königin werden konnte, hatte ihn an Kindes Statt angenommen – aber mehr als all das, er stand da wie sein Vater, die Hände in die Hüften gestemmt, als gehörte ihm die Welt.
Mir wurde klar, daß ich gern noch ein Kind haben wollte. Ich überlegte, wie es wohl sein mochte, ein Kind zu bekommen, das keine Marionette im großen Spiel um den Thron wäre, sondern das nur um seiner selbst willen geliebt wurde. Wie es sein mochte, ein Kind mit einem Mann zu haben, der mich liebte und sich auf das gemeinsame Kind freute.
William Stafford gab mir Geleit zum Richmond Palace und bestand darauf, daß wir frühmorgens aufbrachen, damit die Pferde sich mittags ausruhen konnten. Ich küßte meine Kinder zum Abschied und kam in den Stallhof, wo Stafford mich in den Sattel hob. Ich weinte, und zu meiner großen Verlegenheit fiel eine meiner Tränen auf sein emporgewandtes Gesicht. Er streifte sie sich mit einem Finger ab, führte den Finger zum Mund und leckte ihn ab.
»Was macht Ihr denn da?«
Er blickte schuldbewußt. »Ihr hättet keine Träne auf mich fallen lassen sollen.«
|357| »Ihr hättet sie nicht auflecken sollen«, fuhr ich auf.
Er antwortete mir nicht, wich aber auch nicht von der Stelle. Dann sagte er: »Aufsitzen«, wandte sich von
Weitere Kostenlose Bücher