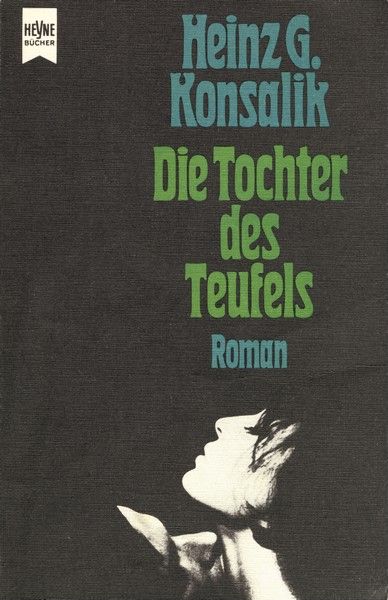![Die Tochter des Teufels]()
Die Tochter des Teufels
zusammen. »Mein Gott! Ein Rückfall? Was ist denn geschehen?« Er rannte in den Salon und riß den Telefonhörer hoch. »Hat man Professor Lassinier schon verständigt? Warum reden Sie nicht, Schwester? Ich will Ihren Bericht haben! Nadja ging es doch blendend, als ich heute morgen fortfuhr!«
»Bitte, Monsieur. Das fand ich neben Frau Gurjewa auf dem Teppich.«
Die Krankenschwester hielt einen Brief hin, den ihr Gabriel mit finsterer Miene aus der Hand riß. »Ich mußte ihn lesen, um die Ursache des neuen Zusammenbruchs zu erkennen. Verzeihen Sie, Monsieur.«
Gabriel überflog die mit einer Schreibmaschine geschriebenen Zeilen. Sein gutmütiges Gesicht war wie versteinert.
»Das ist ein teuflischer Brief«, sagte er leise. »Es muß ein Verrückter sein, der so etwas schreibt! Jawohl, ein Verrückter!« Er faltete das Papier zusammen und schob es in seine Brusttasche. »Ich kann Nadja jetzt nicht sehen?«
»Nein, Monsieur. Ich habe ihr eine Injektion gegeben. Sie schläft ganz fest.«
»Am Sonntag um acht Uhr abends.« Gabriel starrte vor sich hin. Er schlang die Finger ineinander, daß sie knackten. »Er wird seine Geliebte bekommen! Und Augen wird er machen, wenn sie den Schleier fallen läßt.« Er stand auf, zögerte und nickte dann. Er zog den Brief aus der Tasche und gab ihn der Krankenschwester zurück.
»Legen Sie ihn wieder ins Schlafzimmer, Mademoiselle«, sagte er. »Und verraten Sie Nadja nicht, daß ich ihn gelesen habe …«
»Nein, Monsieur.«
Den ganzen Tag über blieb Gabriel zu Hause und grübelte. Er hatte über seinen Sekretär alle Besprechungen absagen lassen, lief in der großen Wohnung an der Avenue Foch ruhelos hin und her, machte Pläne und verwarf sie wieder. Den Brief hatte er fast auswendig gelernt, und ein Satz war es, der ihn stutzig gemacht hatte und über den er immer wieder stolperte: »Es war ein Fehler, Dich mit meinem Freund Gabriel zusammengetan zu haben …«
Mein Freund Gabriel! Wer in Paris hatte das Recht, so von ihm zu reden? Er ging in Gedanken alle Namen durch, die in seinem Leben eine Rolle gespielt hatten oder noch spielten. Dabei kam er zu dem verblüffenden Ergebnis, daß nur vier Männer in Paris sich wirklich seine Freunde nennen konnten: der Großimporteur Jacques Lemaire, der Bankier Gérard Cassini, der Minister und Advokat a.D. Jules Montesson und der pensionierte General Eberhard de Carnot.
Lemaire hatte die Gicht und eine strenge Frau, die ihn keinen Tag ohne Beobachtung ließ. Montesson, das wußte Gabriel genau, weilte, seit zwei Monaten zu Besuch bei seiner verheirateten Tochter in New Orleans. General Carnot stand jenseits von Gut und Böse, hatte sich nie für Frauen interessiert, sondern immer nur für die Aufstellung von Aufmarschplänen gegen die Deutschen. Gérard Cassini … hier stutzte Gabriel. Cassini war der einzige, der jünger war als Gabriel, der Geld genug hatte, sich ein Leben nach seinen ausgefallensten Wünschen zu gestalten, und der auch Gebrauch davon machte. Seine Liebesabenteuer waren bekannt in Paris …
Cassini! Gabriel starrte aus dem Fenster auf die Avenue Foch. Seine Finger trommelten unruhig gegen die Scheiben. Kleinigkeiten, Bemerkungen, hingeworfene Worte bekamen plötzlich einen Sinn.
Vor elf Tagen, im Golfklub. Cassini sagte leichthin: »Mein bester Jean, man munkelt, daß du und La Russe … ein Goldvögelchen, mein Bester. Aber es hat einen starken Schnabel und wird auch deinen Goldkäfig durchnagen …« Und Freitag, vergangene Woche, bei einem Essen der Bankdirektoren im Coque d'Or : »Du heiratest La Russe, mein Guter? Wie lange willst du noch leben?« Und dann die kurze Begegnung im Moulin Rouge, am ersten Abend mit Nadja. Cassini kam an ihrem Tisch vorbei, sein Lächeln war gemein, wie nur Freunde lächeln können, die die Geheimnisse des anderen kennen. Und Nadja hatte abwehrend, ja feindlich reagiert.
Cassini! Ein dummer, ein irrer Verdacht – aber er saß jetzt in Gabriels Herzen wie ein glühender Dorn. Man müßte mit ihm darüber sprechen, dachte er. Von Freund zu Freund! Und man sollte plötzlich kommen, ohne Anmeldung, einfach dasein und an dem hohen Tor von Cassinis Schloß im Wald in der Nähe von Versailles klingeln. Verdammt, das sollte man wirklich machen, und zwar sofort.
»Meinen Wagen!« rief Gabriel ins Haustelefon, das ihn mit der im Erdgeschoß liegenden Wohnung seines Chauffeurs verband. »In zehn Minuten fahren wir!«
Bevor er die Wohnung verließ, ging er noch einmal in seine
Weitere Kostenlose Bücher