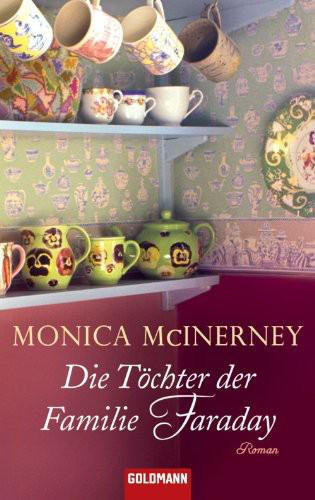![Die Toechter der Familie Faraday]()
Die Toechter der Familie Faraday
jemandem verwechselt. Mit der Schwester, die ich vor zwanzig Jahren zuletzt gesehen habe.
Aber wenn es Sadie gewesen wäre, was hätte sie gesagt? »Hi, wie geht’s denn so? Lust auf einen Kaffee? Ach übrigens, tut mir leid, dass wir uns damals alle gegen dich gestellt haben. Du hattest recht, alle Bande zu kappen. Aber wollen wir die Vergangenheit nicht ruhen lassen?«
Das hätte ein großartiges Donegal-Treffen gegeben, wenn Eliza mit Sadie an ihrer Seite erschienen wäre.
Eliza hatte es den anderen niemals erzählt, aber sie hatte im Verlaufe der letzten Jahre häufig versucht, Sadie ausfindig zu machen. Natürlich musste sie Clementines Standpunkt respektieren – schließlich hatte jene furchtbare Zeit sie am schlimmsten getroffen -, aber die Wahrheit lautete schlicht und ergreifend, sie vermisste Sadie. Ja, was sie getan hatte, war schrecklich. Aber irgendwo auch verständlich. Waren sie nicht alle in Maggie vernarrt gewesen?
Eliza hatte sich oft gewünscht, sie wäre damals dabei gewesen, als Leo und Clementine Sadie und Maggie auf dem Campingplatz gefunden hatten.
Leo hatte ihnen später alles erzählt. Er hatte versucht, mit Sadie zu reden, ihr begreiflich zu machen, wie besorgt sie alle gewesen waren, dass ihre kurzen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter nicht genügt hätten, ihr begreiflich zu machen, warum Clementine so außer sich war. Doch es war, als würde man gegen Wände sprechen, berichtete er. Sie hatte ihm nichts erklärt, sie wollte nur in Ruhe gelassen werden.
Das hatte er getan. Er war mit Clementine und Maggie zum Mietwagen gegangen und in das nahe gelegene Motel gefahren. Maggie hatte sich völlig normal benommen, fröhlich drauflosgeplappert, als ob es auch völlig normal wäre, dass er und Clementine dort einfach erschienen waren.
Am nächsten Morgen war Leo zum Campingplatz zurückgekehrt. Er war zu spät gekommen. Sadie war fort. Er hatte mit dem Mann im Büro gesprochen. Sadie hatte nichts hinterlassen, nur eine Plastiktüte mit Maggies Sachen.
Sie waren alle in Sorge gewesen, dass sie etwas Unüberlegtes tun könnte. Sich umbringen könnte. Leo hatte Tage am Telefon verbracht und mit Polizei und Krankenhäusern in der Umgebung gesprochen. Man war ihm zwar mit einem gewissen Mitgefühl begegnet, doch eine Hilfe war niemand. Wohl ein häuslicher Streit, hatte es geheißen. Es käme täglich vor, dass junge Frauen Streit mit ihrer Familie hatten und ins Ungewisse aufbrachen.
Als dann an Maggies Geburtstag die Karte eingetroffen war, war Eliza unendlich erleichtert gewesen, so wie die anderen auch. Im folgenden Jahr traf eine weitere Karte für Maggie ein. Im Jahr darauf noch eine. Obwohl sie keine weiteren Nachrichten enthielten, waren sie ihnen allen ein Trost. Leo hatte Vater Cavalli, und in späteren Jahren die anderen Priester, immer wieder gefragt, ob sie mehr wüssten. Sie mussten doch wissen, wo sie war. Sicher verstand ein Priester, was diese Situation für die Familie bedeutete. Die Priester waren immer verständnisvoll, aber nie sonderlich entgegenkommend. Sie müssten Sadies Entscheidung respektieren, lautete die Standardauskunft. Während all der Jahre hatten Leo und ihre Schwestern Briefe geschrieben und mit Maggies Karten und Weihnachtsgrüßen verschickt. Aber sie wurden niemals beantwortet.
Eliza versuchte häufig, sich vorzustellen, wie Sadie wohl mittlerweile aussah, wo sie lebte und was sie tat. Das machte sie mit allen Mitgliedern ihrer Familie. Sie stellte sich Leo bei seinen Reisen vor, Juliet in England, bei der Arbeit, Miranda in einer eleganten Bar, mit einem Glas Champagner in der Hand, Clementine im Busch oder an einer Küste auf einen Felsen gekauert. Maggie – bis vor drei Monaten – in einem schicken Büro in London. Aber Sadie? Sie konnte sich nichts ausmalen. Wo mochte sie sein? Bei wem? Wie mochte es ihr ergehen? War sie glücklich? Traurig? Enttäuscht? Erfüllt?
Eliza hätte sich diese Fragen selbst stellen können. Doch sie kannte die Antworten. Sie hatte lange genug darüber nachgedacht. Sie war alles zugleich.
»Kann ich Ihnen helfen?« Ein älterer Herr in einem dunklen Anzug mit weißem Kragen stand am Ende der Bank.
»Nein, danke, Vater.« Sie lächelte ihn flüchtig an, dann stand sie auf und ging, so schnell sie konnte, hinaus in das abendliche Sonnenlicht.
23
Clementine neigte nicht zu Gefühlsausbrüchen, besonders nicht, wenn sie allein war, aber der Brief, den sie gerade erhalten hatte, verlangte nach etwas Besonderem. Sie
Weitere Kostenlose Bücher