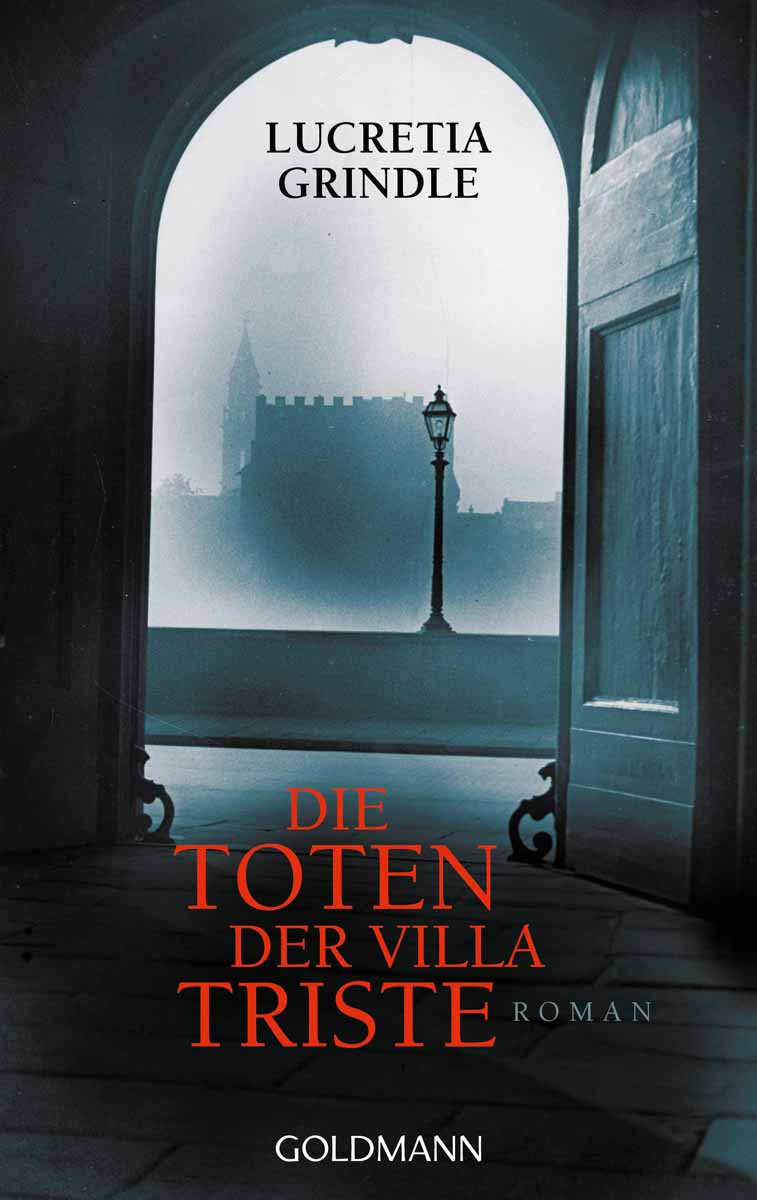![Die Toten der Villa Triste]()
Die Toten der Villa Triste
seit jener grauenhaften Nacht im Dezember nicht mehr gesehen, als er beobachtet hatte, wie ich Dieters Umarmung erwidert hatte. Er war so still wie eh und je, eher noch mehr in sich gekehrt, als hätte ihn der Winter in sein Inneres zurückgetrieben. Als ich ihm ins Gesicht sah, konnte ich hinter der Brille keine Augen ausmachen. Doch als er mir die Hand auf die Schulter legte, war das ebenso befremdlich wie tröstlich, und das Lachen in meiner Kehle erstarb.
Er berührte mich wieder, als wir an die Straßensperre kamen; es war ein sanfter, aufmunternder Druck an meinem Ellbogen. Ich war vorbereitet. Ich dachte, Dieter wäre da. Ich dachte, ich müsste ihm ins Gesicht sehen. Ich dachte, ich müsste lächeln und seinen Namen aussprechen. Aber dann blieb mir all das erspart. An der Straßensperre tat ein unbekannter Soldat Dienst. Er hörte sich ungeduldig meine Erklärungen über das Kloster in Fiesole, über die Verwundeten und die fehlenden Betten an, warf dann einen kurzen Blick auf die Papiere und winkte uns weiter. Gerade als wir unter der erhobenen Schranke durchfahren wollten, beugte er sich in mein Fenster. Ich glaubte schon, das Herz würde mir stehen bleiben. Aber er wollte uns nur ermahnen, ohne Licht zu fahren, um den alliierten Bombern kein Ziel zu bieten …
Es war derselbe Schuppen wie damals. Alles war genau wie damals, nur dass es Frühling war und dass statt des nackten Geästs und des toten Laubs die Wälder oberhalb des Klosters in frischem Grün erblüht waren. Es dämmerte gerade erst, darum brauchten wir keine Lampe, nicht einmal im Schuppen. Wie gewöhnlich erwarteten uns Issa und Carlo, und sobald ich ausstieg, sie bei den Schultern nahm und sie an mich drückte, um sie zu küssen, spürte ich es. Sie sah die Frage in meinem Blick und nickte. Dann drückte sie mich ebenfalls und flüsterte: »Aber verrate es niemandem.«
»Weiß Carlo Bescheid?«
Sie lächelte. »Natürlich. Aber das genügt einstweilen.«
Ich wusste, warum sie das wollte – niemand sollte wissen, dass sie schwanger war, weil sie Angst hatte, dass die anderen sie dann davon abhalten könnten, über die Berge zu wandern, dass man sie daran hindern könnte, das zu tun, was sie am allerliebsten tat.
Wir fuhren im Lauf des Mais noch mehrere Male, und ich sah Issa öfter. Aber weil sie inzwischen nur noch Männerkleidung trug, ahnte niemand, dass in ihrem Bauch Carlos Kind heranwuchs. Carlo und sie waren so gut wie ständig beisammen. Alleine bekam ich Issa so gut wie nie zu sehen. Bei jedem neuen Treffen erschien sie mir strahlender, gesünder, in sich ruhender, und wieder hatte ich das Gefühl, dass wir gemeinsam eine Sanduhr bildeten. Je mehr mein Leben zerrann, je bleicher und gemeiner ich vor Angst und innerer Leere wurde, desto mehr blühte Issa auf. Sie drehte sich, wie eine wunderschöne Blüte, stets der Sonne zu.
Merkwürdigerweise schien vor allem Il Corvo zu spüren, was ich empfand. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich wusste, aber uns einte etwas Ähnliches – ein natürlicher Fluchtinstinkt. So, als läge tief in unserem Herzen ein versteckter, niemals austrocknender Tümpel aus Angst, in den wir immer wieder abzurutschen drohten.
Dieses Gefühl, uns gegenseitig ins Herz blicken zu können und dort vertrautes Gebiet vorzufinden, verleitete mich eines Abends im Mai dazu, nach seiner Schwester zu fragen. Er hatte nie wieder von seiner Schwester oder seiner Mutter gesprochen, aber ich fragte mich, ob sie vielleicht ebenfalls jünger war als er, schöner und begabter – ob wir vielleicht auch das gemeinsam hatten. Darum erkundigte ich mich nach ihr. Erst fragte ich, ob die beiden in Sicherheit waren, und er nickte. Das gab mir Auftrieb, darum fragte ich ihn, ob sie ihm teuer waren. Wie ein Schatz, meinte ich, oder ein Edelstein, auf den man aufpassen musste. Wahrscheinlich war das eine törichte Frage, und er antwortete so lange nicht darauf, dass ich glaubte, er würde gar nichts dazu sagen. Dann sagte er etwas sehr Merkwürdiges und wahrscheinlich Wahres.
Er sagte: »Das tut nichts zur Sache, denn die beiden sind meine Familie.«
Hinter dem Lenkrad des Krankenwagens drehte er den Kopf zur Seite und sah mich an, und sein Gesicht, dieses lange, fremdartige Gesicht mit der kleinen runden Brille, wirkte wie verändert. Zu meinem Erstaunen sah ich darin weder Angst noch Liebe, sondern Trauer. Was wohl manchmal dasselbe ist.
»Sie sind meine Familie«, sagte er noch einmal, als wäre damit alles
Weitere Kostenlose Bücher