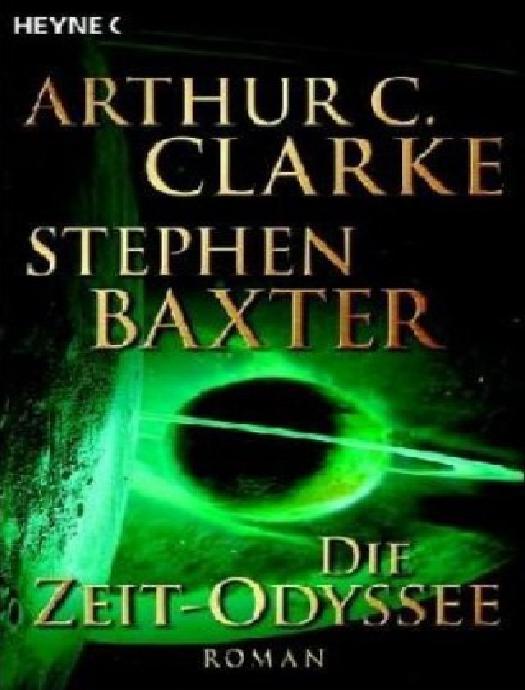![Die Zeit-Odyssee]()
Die Zeit-Odyssee
diese Kontakte auf höchster Ebene nicht geschafft haben. Die
Oikumenen fallen so wenig auf, dass man fast glauben könnte,
es handle sich um eine Untergrundbewegung, aber sie sind da und
arbeiten sich voran.«
Das Gespräch führte ihm vor Augen, wie fern Bisesas
Zeitalter dem seinen lag, und wie wenig er davon verstand.
Vorsichtig fragte er: »Und hat man Gott aus Ihrem Leben
verbannt, wie manche unserer Denker prophezeien?«
Sie zögerte. »Nicht verbannt, Josh. Aber wir
begreifen uns selbst jetzt besser als früher. Wir begreifen,
weshalb wir Götter brauchen. Es gibt etliche Leute in
meiner Zeit, die jede Art von Religion als Psychopathologie
ansehen. Sie zeigen mit dem Finger auf Menschen, die um eines
verschwindend kleinen Unterschiedes in einer unklaren Ideologie
willen bereit sind, ihre Glaubensbrüder zu foltern und zu
töten. Andere wiederum meinen, dass die Religionen
ungeachtet ihrer Schwachpunkte Anläufe sind, sich der
grundlegendsten Fragen unserer Existenz anzunehmen. Selbst wenn
sie uns nichts über Gott sagen, sagen sie ganz gewiss eine
Menge darüber, was es heißt, Mensch zu sein. Die
Oikumenen hoffen, dass durch eine Vereinigung aller Religionen
das Resultat keine Verwässerung bringt, sondern eine
Bereicherung – vergleichbar der Möglichkeit, ein
kostbares Schmuckstück aus verschiedenen Blickwinkeln zu
betrachten. Und vielleicht sind diese ersten versuchsweisen
Schritte unsere beste Hoffnung für ein wahres Zeitalter der
Aufklärung in der Zukunft.«
»Das klingt utopisch. Und funktioniert es?«
»Langsam. Wie die Sicherung des Friedens. Falls wir
tatsächlich dabei sind, ein Utopia zu schaffen, dann wohl
ziemlich im Verborgenen. Aber wir versuchen es, denke
ich.«
»Das ist eine wunderbare Vision«, flüsterte
er. »Die Zukunft muss etwas Herrliches sein.« Er sah
sie an. »Wie unbegreiflich all das ist! Wie aufregend
– gemeinsam mit Ihnen hier zu sein – als Strandgut
der Zeit, sozusagen, zusammen mit Ihnen…«
Sie streckte die Hand aus und legte ihm eine Fingerspitze auf
die Lippen. »Gute Nacht, Josh.« Sie rollte sich
herum, zog sich den Poncho über die Schultern und machte
sich klein darunter.
Er legte sich wieder hin; sein Herzschlag hämmerte.
Am nächsten Tag ging es stetig bergan, und das
zerklüftete Land war bar jeglichen Lebens. Die klare Luft
wurde zusehends dünner und kälter und trotz hellem
Sonnenschein bitter kalt, wenn der Wind aus dem Norden kam. Zu
diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass weder von den
Paschtunen noch von irgendjemandem sonst Gefahr drohte. So
gestattete Batson den Truppen, die mühselige Routine des
Aussendens von Spähern einzustellen, was ein flotteres
Vorwärtskommen erlaubte.
Bisesas Allwettermontur hielt sie einigermaßen warm,
doch die anderen litten unter der Kälte. Als ihnen der Wind
ins Gesicht blies, wickelten sich die Soldaten in ihre Decken und
verwünschten sich murrend und fluchend, weil sie nicht ihre
Wintermäntel mitgenommen hatten. Ruddy und Josh wurden
schweigsam und in sich gekehrt, als würde ihnen der Wind
alle Energie aus dem Leib ziehen. Aber niemand hatte diese
Wetterbedingungen erwartet; selbst alte Grenzlandhasen
beteuerten, sie hätten hier noch nie zuvor eine solche
Kälte im März erlebt. Dennoch marschierten sie alle
verbissen weiter. Die meiste Zeit über ließ sogar
Kipling das Jammern; er sagte, ihm sei zu kalt, um sich auch noch
damit herumzuschlagen.
Vierzehn der zwanzig Rekruten waren Inder. Mit der Zeit schien
es Bisesa, als würden sich die Europäer von den Sepoys fern halten, und ihr fiel auf, dass die Inder
minderwertigere Waffen und Ausrüstungen hatten.
»Einst war das Verhältnis der britischen Truppen zu
den indischen eins zu zehn«, erklärte Ruddy,
»aber durch die Meuterei hat sich das alles geändert.
Heute haben wir einen Europäer für je drei Inder. Die
besten Waffen und alle Artillerie sind in den Händen
britischer Soldaten, obwohl für den Maultiertransport auch
Inder als Treiber Verwendung finden. Man möchte ja nicht
potenzielle Aufständische ausbilden und bewaffnen, nicht
wahr. Sagt einem der gesunde Menschenverstand. Sie müssen
bedenken, dass nur etwa tausend Personen – alles brave
Leute aus dem Flachland! – im indischen Staatsdienst
stehen, um ein Land mit einer Einwohnerschaft von vierhundert
Millionen zu verwalten! Nur der Rückhalt durch das
Militär ermöglicht es, ein solches Gaukelspiel
Weitere Kostenlose Bücher