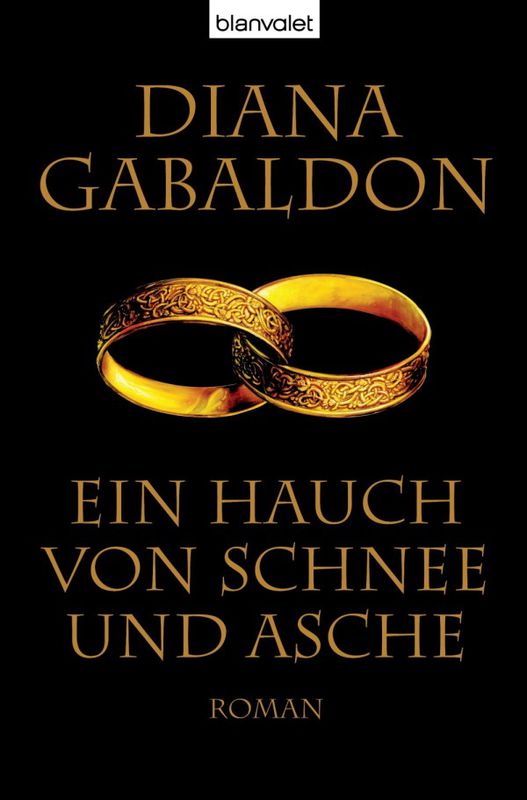![Ein Hauch von Schnee und Asche]()
Ein Hauch von Schnee und Asche
ich ihre langen Nasen sehen konnte, die vorwitzig in den Nebel ragten: Mutter Covington und ihre Tochter, so nannten die Männer die beiden Kanonen – ich fragte mich müßig, welche wohl welche war und wer zum Teufel die richtige Mutter Covington gewesen sein könnte. Wahrscheinlich eine Respekt einflößende Lady – oder vielleicht ja die Betreiberin des örtlichen Bordells.
Brennholz war leicht zu finden; der Eissturm hatte auch vor den Kiefern am Bach nicht Halt gemacht. Allerdings war es verdammt feucht, und ich hatte nicht vor, eine Stunde mit einer Zunderbüchse auf den Knien zu verbringen. Zum Glück konnte in dieser Suppe ja niemand sehen, was ich tat, und so zog ich heimlich eine kleine Dose mit Briannas Streichhölzern aus meiner Tasche.
Während ich auf das Holz blies, hörte ich eine Reihe seltsamer, durchdringender Kreischgeräusche von der Brücke kommen und kniete mich aufrecht hin, um den Hügel hinunterzustarren. Ich konnte natürlich nichts sehen, begriff aber beinahe sofort, dass es das Geräusch nachgebender Nägel war, als die Planken ausgehebelt wurden – sie waren dabei, die Brücke zu demontieren.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis Jamie zu mir kam. Er wollte nichts essen, setzte sich aber an einen Baum und winkte mich zu sich. Ich setzte mich zwischen seine Knie und lehnte mich an ihn, dankbar für seine Wärme: Die Nacht war kalt, und die Feuchtigkeit kroch in jede Ritze und ließ das Knochenmark gefrieren.
»Sie werden doch wohl sehen, dass die Brücke nicht mehr da ist?«, sagte ich nach langem Schweigen, das von den tausend Geräuschen der Männer erfüllt war, die unter uns am Werk waren.
»Nicht, wenn der Nebel bis zum Morgen hält – und das wird er.« Jamie klang resigniert, doch er kam mir friedvoller vor als vorhin.
Wir saßen eine Weile still zusammen und sahen dem Spiel der Flammen im Nebel zu – ein gespenstischer Anblick, da das schimmernde Feuer mit
dem Nebel zu verschmelzen schien, so dass sich die Flammen immer höher reckten, bevor sie in dem wirbelnden Weiß verschwanden.
»Glaubst du an Geister, Sassenach?«, fragte Jamie ganz plötzlich.
»Äh … schlicht und ergreifend, ja«, sagte ich. Er wusste, dass es so war, weil ich ihm von meiner Begegnung mit dem schwarz bemalten Indianer erzählt hatte. Ich wusste, dass er ebenfalls daran glaubte – er war Highlander. »Warum, hast du einen gesehen?
Er schüttelte den Kopf und schlang die Arme fester um mich. »›Gesehen‹ würde ich nicht sagen«, sagte er nachdenklich. »Aber der Teufel soll mich holen, wenn er nicht hier ist.«
»Wer denn?«, sagte ich aufgeschreckt.
»Murtagh«, sagte er und überraschte mich noch mehr. Er setzte sich bequemer zurecht und ich schmiegte mich wieder an ihn. »Seit der Nebel aufgekommen ist, habe ich das merkwürdige Gefühl, dass er in meiner Nähe ist.«
»Wirklich?« Das war faszinierend, doch es erfüllte mich auch mit großer Beklommenheit. Murtagh, Jamies Patenonkel, war in Culloden gestorben und seitdem – soweit ich wusste – niemandem erschienen. Ich zweifelte nicht an seiner Präsenz – Murtagh hatte eine sehr starke, wenn auch etwas sauertöpfische Persönlichkeit besessen -, und wenn Jamie sagte, dass er hier war, war es wahrscheinlich auch so. Was mir Sorgen machte, war die Frage, warum er wohl hier sein mochte.
Ich konzentrierte mich eine Weile, konnte den schmächtigen Schotten aber selbst nicht spüren. Offenbar interessierte er sich nur für Jamie. Das machte mir Angst.
Der Ausgang der morgigen Schlacht stand zwar fest, doch Schlacht war Schlacht, und es konnte auch auf der Siegerseite Tote geben. Murtagh war Jamies Patenonkel gewesen und hatte seine Pflicht sehr ernst genommen. Ich hoffte sehr, dass ihm nicht zu Ohren gekommen war, dass Jamie im Begriff stand, sein Leben zu verlieren, und dass er nicht hier aufgetaucht war, um ihn in den Himmel zu begleiten. Visionen am Vorabend der Schlacht waren fester Bestandteil der Highland-Folklore, aber Jamie hatte nichts davon gesagt, dass er Murtagh gesehen hatte. Das war immerhin etwas, dachte ich.
»Er, ähm, hat aber nichts zu dir gesagt, oder?«
Jamie schüttelte den Kopf. Ihn schien der Geisterbesuch nicht nervös zu machen.
»Nein, er ist einfach nur … da.« Er schien dieses »Da-Sein« sogar als tröstend zu empfinden, daher sprach ich meine Zweifel und Ängste nicht aus. Doch ich verspürte sie trotzdem und verbrachte den Rest der kurzen Nacht dicht an meinen Mann gedrückt, wie um Murtagh
Weitere Kostenlose Bücher