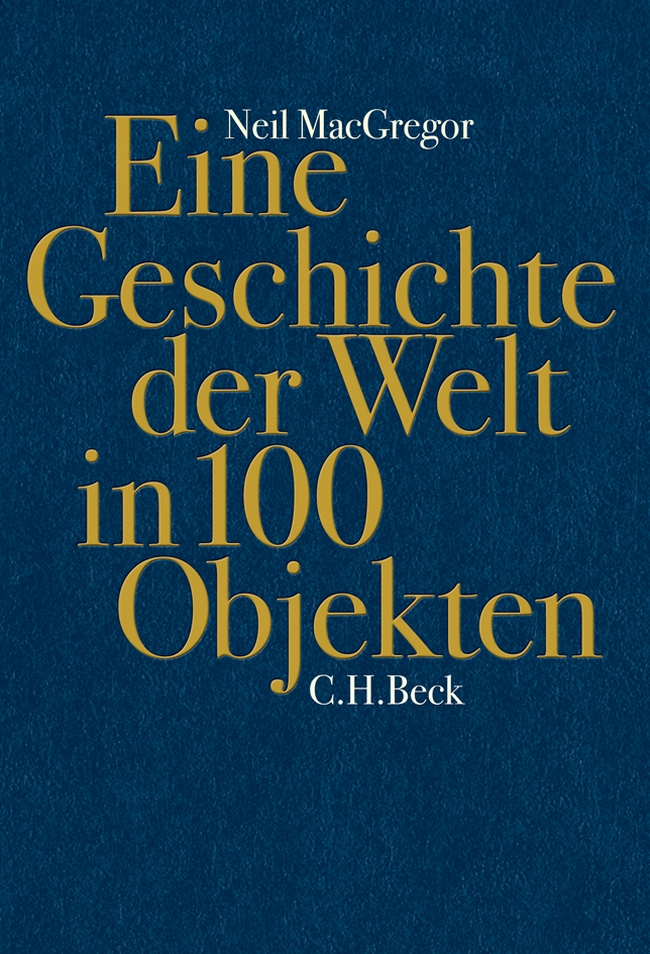![Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten]()
Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten
Alibi, das es anderen Gesellschaften erlaubte, über Homosexualität nachzudenken, über Homosexualität zu sprechen, Homosexualität darzustellen, wie das seit dem 18. Jahrhundert und sogar im Mittelalter der Fall war. Das machte sie eher zu einem Stück Kunst als zu Pornographie.»
Es gibt keinen Zweifel, wo diese homosexuellen Begegnungen stattfinden. Die Musikinstrumente, die Möbel, die Kleidung und die Haartracht der Liebenden verweisen allesamt auf die Vergangenheit – auf das Griechenland der klassischen Antike einige Jahrhunderte zuvor. Interessanterweise können wir an unserem Becher erkennen, dass die beiden jüngeren Männer keine Sklaven waren. Ihre Frisur mit der langen Locke, die sich den Rücken hinabschlängelt, ist typisch für freigeborene griechische Knaben. Im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurde das Haar dann im Zuge des Übergangs ins Mannesalter abgeschnitten und einerGottheit gewidmet. Die beiden auf dem Becher dargestellten Knaben sind also Freie und stammen aus gutsituierten Familien. Wir erkennen allerdings auch noch eine andere Gestalt, die Teil des römischen Banketts gewesen sein könnte, auf welchem unser Becher benutzt wurde. Sie steht im Hintergrund und beobachtet heimlich durch den Türspalt eine der Liebesszenen – wir sehen ihr Gesicht nur zu Hälfte. Es handelt sich mit Sicherheit um einen Sklaven, auch wenn sichunmöglich feststellen lässt, ob ihn einfach seine voyeuristische Neugier antreibt oder ob er ängstlich einem Ruf nach dem «Zimmerservice» Folge leistet. Wie auch immer, er erinnert uns auf alle Fälle daran, dass die Akte, deren Zeuge er und wir werden, nur im Privaten hinter verschlossenen Türen vollzogen werden. Noch einmal Bettany Hughes:
Ein Sklavenjunge lugt durch den Türspalt, um die Liebenden zu beobachten.
«In Rom herrschte die Vorstellung, dass man gute Frauen habe und deshalb des Sexes mit Männern nicht bedürfe. Doch wir wissen aus der Dichtung, aus den Gesetzen, aus den Hinweisen auf homosexuelle Beziehungen, dass das in Wirklichkeit überall in der römischen Welt geschah. Dieser Becher verrät uns, was sich wirklich zutrug, dass homosexuelle Aktivität etwas war, das in hohen aristokratischen Kreisen stattfand.»
Silberbecher aus dieser Zeit sind ausgesprochen selten, da sehr viele eingeschmolzen wurden, und von den verbliebenen reichen nur wenige an die handwerkliche Virtuosität des Warren Cup heran. Um einen Becher wie diesen zu kaufen, musste man reich sein, denn er dürfte um die 250 Denare gekostet haben – für dieses Geld hätte man 25 Krüge besten Weins, zwei Drittel Morgen Land oder sogar einen ungelernten Sklaven wie denjenigen, der auf dem Becher um die Tür lugt, bekommen. Dieses unscheinbare kleine Stück Geschirr reihte seinen Besitzer eindeutig in die Ränge der «High Society» ein, in die Welt, die der Apostel Paulus wegen ihrer Trunkenheit und Unzucht so beredt verurteilte.
Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber man vermutet, dass der Warren Cup in der Nähe von Bittir, einer Stadt ein paar Kilometer südwestlich von Jerusalem, ausgegraben wurde. Wie er dort hinkam, bleibt ein Rätsel, aber wir können zumindest eine Vermutung anstellen. Die Herstellung des Bechers lässt sich ungefähr auf das Jahr 10 n. Chr. datieren. Rund fünfzig Jahre später sorgte die römische Besetzung Jerusalems für Spannungen zwischen den Herrschenden und der jüdischen Gemeinde, die im Jahr 66 zur Explosion führten. Die Juden eroberten die Stadt gewaltsam zurück. Es kam zu blutigen Auseinandersetzungen, und unser Becher wurde möglicherweise von seinem Besitzer vergraben, bevor dieser vor den Kämpfen floh.
Danach verschwand der Becher für fast zwei Jahrtausende, ehe er 1911 von Edward Warren in Rom käuflich erworben wurde. Nach dessen Tod 1928 erwies es sich jahrelang als unmöglich, den Becher zu verkaufen – die Szenen daraufwaren für potenzielle Sammler viel zu schockierend. In London lehnte es das Britische Museum ab, ihn zu kaufen, nicht anders als das Fitzwilliam Museum in Cambridge, und einmal wurde sogar seine Einfuhr in die USA verboten, weil die expliziten Sexszenen einen Zollbeamten auf den Plan gerufen hatten. Erst 1999, als sich die Haltung zur Homosexualität schon längst geändert hatte, kaufte das Britische Museum den Warren Cup – damals die teuerste Erwerbung, die das Museum je getätigt hatte. Eine Karikatur zeigte damals einen römischen Barmixer, der einen Gast freundlich fragte: «Wollen Sie einen hetero
Weitere Kostenlose Bücher