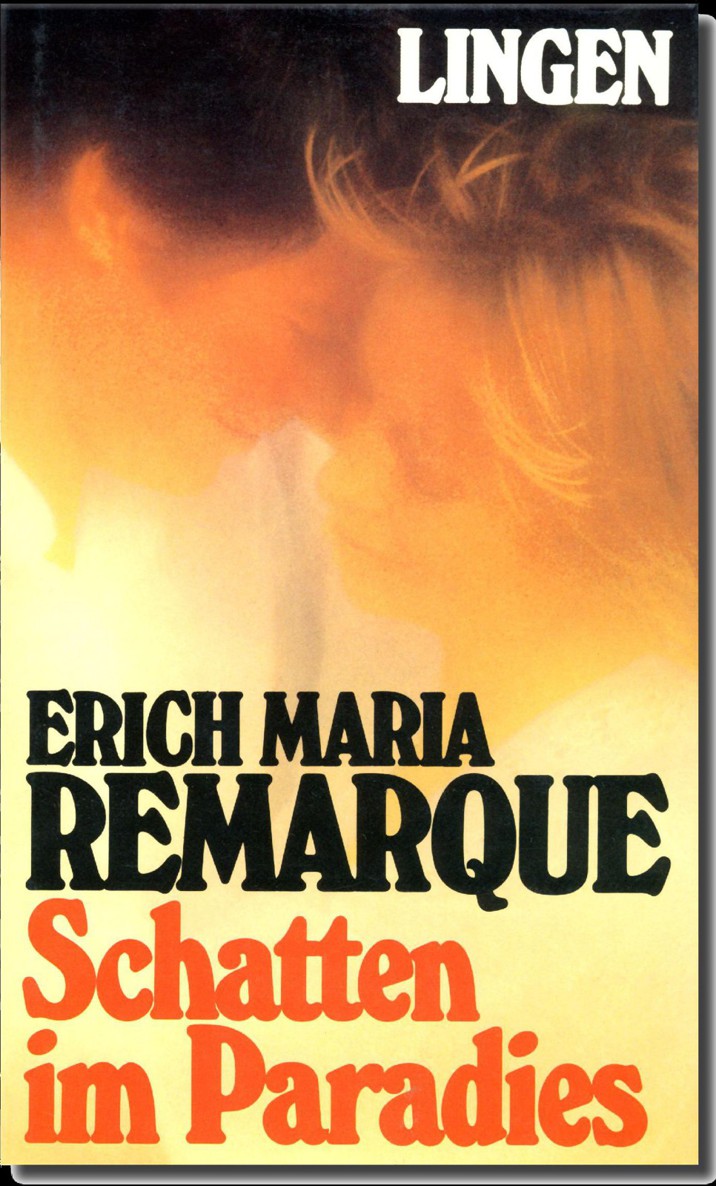![E.M. Remarque]()
E.M. Remarque
Denkmal
Schillers, das sich ebenso fremd ausnahm. Vielleicht hatte ein Auslanddeutscher
es vor Jahrzehnten gestiftet. Im Augenblick hatte ein Erotiker es verschönt.
Mit roter Farbe war ein üppiger gebückter Frauenhintern darauf gezeichnet, der
von einem Mann mit einer Brille von hinten vergewaltigt wurde. Es war nicht
einmal eine ungeschickte Zeichnung, aber sie paßte schlecht zum Verfasser der
›Jungfrau von Orléans‹. Ich wanderte weiter und wurde von einem würdigen
Vollbart angesprochen. Ich vermutete zuerst, er sei der Maler, merkte aber, als
er fragte, ob ich schon gefrühstückt hätte, daß ich einen lyrischen
Homosexuellen vor mir hatte, und schüttelte ihn ab. Inzwischen war es Zeit
geworden, ins Museum zu gehen.
Ich war schon mehrere Male dagewesen. Es
erinnerte mich an die Zeit, die ich im Museum in Brüssel zugebracht
hatte – und merkwürdigerweise am meisten an die Stille darin. Die
grenzenlose, gequälte Langeweile der ersten Monate dort, die monotone Spannung,
die ständige Angst dieser Zeit, entdeckt zu werden, die erst allmählich in eine
Art fatalistische Gewohnheit übergegangen war, alles das schien unter den
Horizont gesunken zu sein. Geblieben war nur die unheimliche Stille, dieses
Herausgehobensein aus jedem Zusammenhang, dieses Leben in dem stillen Kern
eines Tornados, umbraust von den Wirbeln des Sturms, aber immer scheinbar
geborgen in einer Windstille, in der kein Segel flatterte oder sich rührte.
Ich hatte beim ersten Mal Angst gehabt, daß
in mir mehr wieder geweckt würde, aber es war, als berge mich dieses Museum in
New York in dieselbe schützende Stille. Nichts hatte sich gerührt, als ich
zögernd durch die Räume schritt. Der Friede, der selbst von den
leidenschaftlich bewegten Kampfszenen an den Wänden ausging und der etwas
sonderbar Metaphysisches hatte, etwas von einem ›Hinter allem‹ und ›Nach
allem‹ – dieser ungeheure Friede der Vergangenheit, der Friede war, gerade
weil er vergangen war, dieser Friede, von dem der Prophet sprach, als er sagte,
daß Gott nicht im Sturm, sondern in der Stille sei – dieser durchsichtige
Friede hielt alles an seinem Ort, er ließ den Krieg nicht mehr in der Fläche da
sein und nicht mehr im Raum kämpfen, und er schien auch mich zu schützen. Ich
hatte hier, in diesen Räumen, plötzlich das grenzenlose, reine Gefühl des
Lebens gehabt, das die Inder Samadhi nennen und das man nie vergißt, wenn es
einmal wie eine steile Fontäne zwischen den Augen aufgebrochen ist und sich
über einem verliert, ganz gleich, ob es bleibt oder nicht. Was bleibt, ist der
Reflex der bezaubernden Illusion der Welt: Daß Leben ewig ist und daß wir ewig
leben, wenn es nur gelingt, die Schlangenhaut des Ichs abzustreifen und zu
wissen, daß der Tod eine Verwandlung ist. Ich hatte diese Illusion vor der
Ansicht von Toledo gehabt, dieser düsteren und erhabenen Landschaft Grecos, die
direkt neben dem viel größeren Bilde des Großinquisitors hing, dieses gütigen
Urbildes der Gestapo und aller Folter der Welt. Ich wußte nicht, ob das einen
Zusammenhang hatte, ich fühlte in dieser leuchtenden Sekunde, daß nichts und
alles einen Zusammenhang habe und daß dieser Zusammenhang nichts anderes war
als eine menschliche Krücke, eine Lüge in der einen und eine unfaßliche
Wahrheit in der andern Hälfte. Aber was war eine unfaßliche Wahrheit anders als
eine unfaßliche Lüge?
Es war kein Zufall, der mich ins Museum
gebracht hatte. Der Tod Möllers hatte mich mehr beunruhigt, als ich erwartet
hatte. Im Anfang hatte er mich nicht sehr berührt, denn ich hatte Ähnliches in
Frankreich auf der Flucht oft erlebt. Auch Hastenecker, der
Weitere Kostenlose Bücher