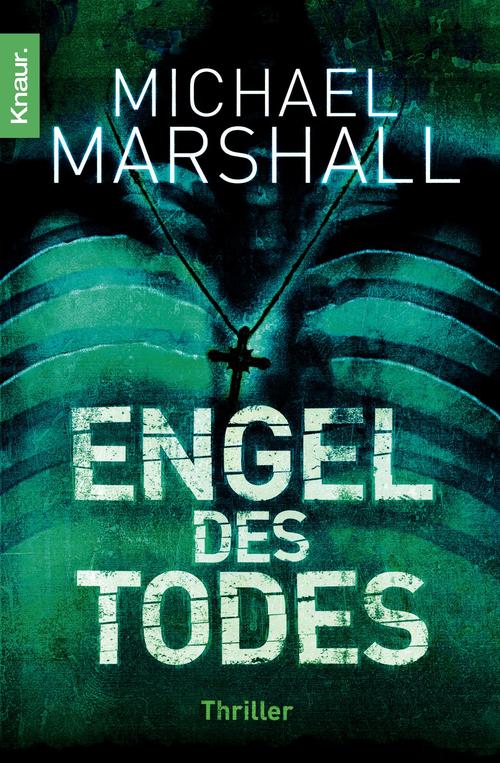![Engel des Todes]()
Engel des Todes
Behördenvertreter schrieb alles auf, was ich angab, doch aus seinen Blicken schloss ich, dass es noch ein langer Tag werden könnte. Am Ende gab er mir eine Nummer und entließ mich wieder in die hustende Schar der Wartenden mit ihren Problemen, Neurosen und Störungen.
Zirka tausend Jahre später erschien endlich meine Nummer. Man wies mich einen langen Flur hinunter und dann in ein Büro, wo eine Beamtin, farbig und Mitte vierzig, an einem mit Papieren übersäten Schreibtisch saß. Aus einem Namensschild ging hervor, dass sie Mrs. Muriel Dupree hieß. An der Wand hinter ihr hingen Poster, auf denen jedes dritte Wort unterstrichen war. Auch wurde Vertraulichkeit zugesichert.
»Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen«, sagte sie mir zur Begrüßung, noch ehe ich mich gesetzt hatte.
Ich setzte mich trotzdem. »Warum nicht?«
»Es ist zu lange her, deswegen.« Sie zeigte auf ein vor ihr liegendes Papier. »Da steht, dass es sich um Ihren Bruder handelt und dass es um 1967 gewesen sein soll. Das war vor meiner Zeit, wie Sie wohl verstehen. Das war auch lange vor einer Reihe anderer großer Umwälzungen, angefangen mit dem da.« Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung auf einen Computer, der so alt aussah, dass der ganze Rechner vermutlich nicht einmal den Arbeitsspeicher meines Laptops gefasst hätte.
»Keine zwanzig Jahre ist es her, dass die gesamte Verwaltung auf EDV umgestellt wurde. Außerdem gab es 1982 einen verheerenden Brand, bei dem alle Akten und Bänder im Kellergeschoss vernichtet wurden. Dabei ging der größte Teil der Unterlagen vor dem Datum der Umstellung verloren. Und selbst wenn es zu Ihrem Fall schriftliche Aufzeichnungen gegeben haben und diese nicht verbrannt sein sollten, war es sicherlich nicht viel, und Sie hätten mehr Chancen, Gott zu finden, als heute noch diese Unterlagen. Ich meine das nicht persönlich. Vielleicht haben Sie IHN ja schon gefunden.«
Meine Enttäuschung stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn sie zuckte die Schultern. »Damals war die Sache anders als heute. Heutzutage wird kein Kind einfach ›zur Adoption freigegeben‹. Vielmehr macht die Mutter einen Adoptionsplan, es gibt gesetzlich vorgeschriebene Bedingungen für die Kontaktaufnahme, und überhaupt sind sich heute alle einig, dass es für das Kind nicht das Beste ist, wie ein unbeschriebenes Blatt neu anzufangen; ein Kind braucht ein Wissen über seine Vergangenheit und so weiter. Aber damals war das anders. Da hieß es: ›Prima, du bekommst Pflegeeltern oder Adoptiveltern. Damit beginnt für dich ein neues Leben. Schau am besten nicht zurück, denn deiner Vergangenheit brauchst du nicht nachzuweinen.‹ Die Leute änderten den Namen und das Geburtsdatum der Kinder. Wissen Sie, wie man die Kinder früher zur Adoption freigegeben hat?«
Ich schüttelte verneinend den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, es war mir auch egal, aber Mrs. Dupree sah in mir offenbar eine willkommene Abwechslung von Klienten, die in ihrem Büro laut wurden.
»Vor langer, langer Zeit setzte man Waisenkinder aus den Küstenstädten in den Zug, der sie hinaus aufs Land brachte. Wenn der Zug dann auf irgendeinem Kleckerbahnhof hielt, stellte man die Kinder auf den Bahnsteig in der Hoffnung, dass ein Farmer, der in seiner Hütte noch etwas Platz hatte, ein oder zwei davon mitnehmen würde. Hier ist das Kind. Füttere es durch. Alles, was vorher war, ist vergangen und vergessen. Ganz so war es nicht mehr in den sechziger Jahren, aber in mancher Hinsicht doch. Meist sagte man den Kindern nicht, dass sie adoptiert worden waren. Und meist warteten die Eltern damit, bis sie meinten, das Kind sei alt genug. Das hieß, bis zur Volljährigkeit – und wenn es dann erfuhr, dass sich Mom und Dad zum Zeitpunkt seiner Geburt womöglich Hunderte von Meilen entfernt aufgehalten hatten, dann fielen sie aus allen Wolken. Das war keine gute Lösung, wie wir heute wissen, aber damals hielt man es für das Beste, und tatsächlich haben ja auch viele dieser Kinder später ein gutes und zufriedenes Leben geführt. Ist Ihnen nicht wohl?«
»Doch, doch«, beteuerte ich und hob den Blick von meinen Händen.
Ich hatte mich gerade gefragt, ob ich irgendjemandem glaubhaft machen könnte, dass ich ein gutes und zufriedenes Leben führte. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen Nachforschungen schon so früh an ein Ende kommen würde. Dabei ist es so wichtig für mich.«
»Ich verstehe.«
Ich schüttelte den Kopf und wäre am liebsten anderswo gewesen.
Weitere Kostenlose Bücher