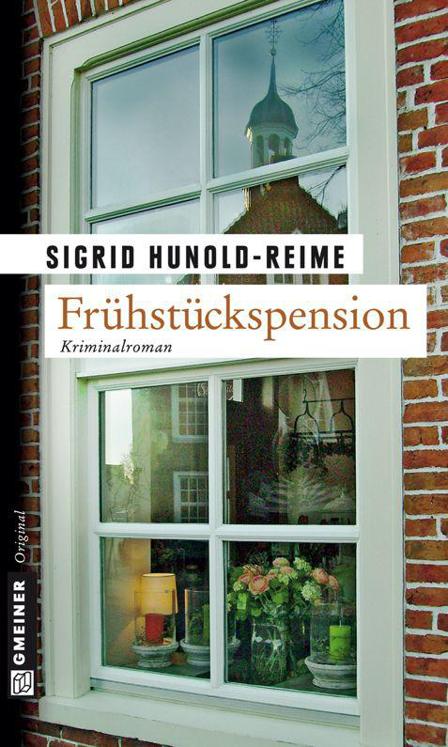![Frühstückspension: Kriminalroman]()
Frühstückspension: Kriminalroman
leicht gegen meins: »Cheers, vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Wollen wir uns nicht duzen?«
Ich nicke herzlich. Seit wir nicht mehr in den Positionen Schwester und Angehörige sind, habe ich das Sie zwischen uns sowieso als unnatürlich empfunden.
»Verstehst du dich gut mit deiner Tochter?«, fragt Maike, und ich höre, dass sie von mir ein deutliches Ja erwartet.
»Sie ist beruflich für zwei Jahre in den USA«, antworte ich ausweichend.
»Sie ist ganz anders als du«, schicke ich leise hinterher.
Maike legt ihren Kopf schief und sieht mich prüfend an.
»Wie anders?«
»Halt anders. Sie ist ein Karrieretyp. Sehr ehrgeizig und sehr selbstständig. Sie braucht mich nicht.«
Die letzten Worte tun mir weh.
Maike setzt sich aufrecht hin. Sie sieht mich mit so viel ernsthafter Strenge an, dass ich mich weiter nach hinten lehne.
»Das ist typisch. Tut mir leid, aber das ist wirklich typisch. Nicht brauchen! Eltern sind eigenartig. Als ob es nur zwei Sorten Kinder gäbe. Die einen überleben ohne Eltern nicht den nächsten Tag. Die anderen schaffen einfach alles und brauchen ihre Eltern überhaupt nicht. Aber jeder Mensch ist doch mal in der einen oder der anderen Position.«
Maike nimmt einen kräftigen Schluck Wein und ereifert sich weiter: »Und was verstehst du überhaupt unter Karrierefrauen? Die im schicken Schwarzen? Unnahbar, als wären sie unverletzbar? An Schlips und Kragen orientiere ich mich schon lange nicht mehr. Glaub mir, ich sehe die Menschen in Ausnahmesituationen. Ohne ihre künstliche Hülle. Da bleibt nichts über, nur die Angst. Die macht alle gleich. Bis auf ein paar Ausnahmen. Das sind wirklich starke Charaktere, die ich bewundere. Aber die trifft man selten, und sie kommen prozentual gesehen nicht häufiger unter Schlipsträgern vor.«
Mit so einer temperamentvollen Einlage habe ich nicht gerechnet.
»Sandra ist immer so kühl«, verteidige ich mich lahm.
»Sandra«, versuche ich weiter zu erklären, »sie wollte immer nur mit meinem Mann reden. Mich hat sie in der letzten Zeit gar nicht mehr wahrgenommen.«
Maike antwortet nicht. Wir schieben unsere Gläser auf dem Tisch hin und her.
»Ich sie auch nicht«, gebe ich zögernd zu. »Ich war erleichtert, als sie ausziehen wollte. Sandra ist zuletzt nur noch anstrengend gewesen.«
Maike sieht mich wieder sanfter an.
»Ruf sie doch einfach mal wieder an«, ermutigt sie mich.
»Das habe ich vor.«
Ich bin verlegen. Suche nach Worten.
Sage endlich: »Wie ging das mit dir weiter? Mit deinem Traumberuf?«
»Der Anfang war so, wie ich ihn mir ausgemalt hatte. Ich habe einen Ausbildungsplatz im Friederikenstift bekommen. Kennst du es?«
Ich nicke, und Maike erzählt weiter:
»Zeitgleich habe ich meinen Freund kennen gelernt. Er hat studiert. Wir sind zusammengezogen. Recht schnell. Jörg wollte aus seiner Wohngemeinschaft und ich aus dem Personalwohnheim raus. Es war mir zu laut. Ich komme aus Schillerslage. Ein Nest bei Hannover, Richtung Celle.«
»Ich kenne Schillerslage«, werfe ich ein. Meine Mutter hatte dort in ganz jungen Jahren eine Affäre mit einem Melker. Manchmal habe ich geglaubt, der war ihre wahre große Liebe. Wenn es die gibt. Auf jeden Fall ihre erste, und sie wurde immer ganz weich, wenn sie von Schillerslage und der Heide sprach.
»Jörg und ich glaubten an ein gemeinsames Ziel. Dabei hatte jeder nur sein eigenes: Das Ende der Ausbildung. Ich finde den Begriff Lebensabschnittspartner total affig, aber für uns hat er gepasst.
Nach dem Examen kamen wir mit unserer Beziehung ins Trudeln. Wir sind als Freunde auseinandergegangen. Es hat trotzdem wehgetan. Ich habe versucht, mich neu zu orientieren. Mein nächstes Ziel war die Intensivstation. Im Stift war auf lange Sicht keine Planstelle frei, und es standen noch andere Kollegen, die schon länger ihr Examen hatten, auf der Warteliste. In Wilhelmshaven war eine Stelle auf der Intensivstation frei. Ich mochte diese Stadt am Meer schon immer, und ich dachte, ein Umzug würde mir guttun und mir helfen, ganz mit Jörg abzuschließen. So einfach ist das. Darum bin ich in Wilhelmshaven gelandet.«
»Und weiter?«
»Die ersten Jahre waren okay. Nein, sie waren mehr als okay. Sie haben richtig Spaß gemacht. Das Team war supernett. Die Arbeit erforderte meine ganze Konzentration. Jeder Tag brachte neue Eindrücke. Das war richtig berauschend.«
»Und privat?«, wage ich mich weiter vor.
»Da hat mir nichts gefehlt. Ich habe mich mit einigen Kollegen
Weitere Kostenlose Bücher