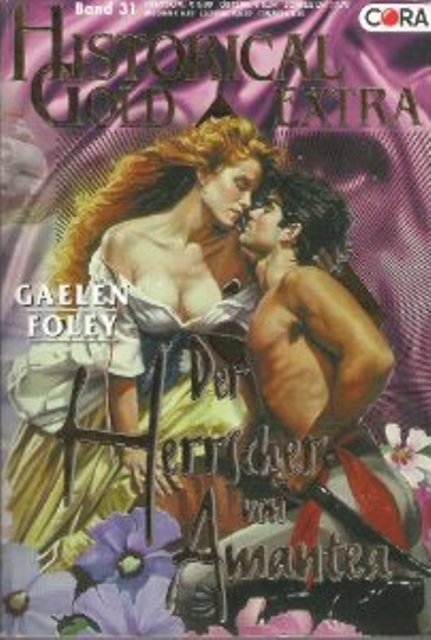![Gaelen Foley - Amantea - 01]()
Gaelen Foley - Amantea - 01
schuldig.“
„Genau das wollte er mit dieser Bemerkung erreichen, chérie.“ Wieder legte sie den Kopf auf seine Schulter und schmiegte sich geradezu an ihn. „Umberto? Noch niemand hat je zuvor meine Ehre verteidigt.“
Er erwiderte nichts.
Maria ...
Der erste Gedanke, der in seinem umnebelten Kopf auf- stieg, war Maria. Er brauchte sie jetzt – Maria, seine willige Geliebte. Maria wusste, wie sie sich um ihn zu kümmern hatte. Er versuchte die Augen zu öffnen, doch es gelang ihm nur beim rechten. Das linke war zugeschwollen. Der Kopf tat ihm weh.
In der Dunkelheit, die ihn umgab, ragten Blumen über ihm auf. Ringelblumen und die trompetenförmigen Blüten der Lilien starrten schweigend wie die Gesichter besorg- ter Frauen auf ihn herab. Einen Moment lang war er sich unsicher, wo er sich überhaupt befand und wie er hierher gekommen war.
Dann fiel ihm alles wieder ein.
Domenico Clemente setzte sich langsam auf, wobei er röchelnd durch den Mund atmete. Das halbe Dut- zend Schläge, das auf seinen Kopf niedergeprasselt war, verblüffte ihn noch immer, als er sich mühsam aufrichtete.
Benommen schwankte er hin und her, da stürzten drei Wachen in den Garten.
„Gnädiger Herr!“
„Sie sind verletzt!“
„Ausgezeichnet beobachtet“, knurrte Domenico und schüttelte den hilfreich dargebotenen Arm eines der Sol- daten ab. Er hielt währenddessen sein schmerzendes rechtes Handgelenk an die Brust gepresst. „Signorina Monteverdi?“
„Er ritt mit ihr auf einem Pferd davon, das er zu- vor gestohlen hatte. Die beiden werden bereits von zwei Schwadronen verfolgt.“
„Wir werden Signorina Monteverdi in kürzester Zeit wieder bei uns haben, Herr. Machen Sie sich keine Sorgen! Spätestens morgen haben wir sie gefunden.“
„Bringt mir diesen Mann“, befahl er mit leiser, bedroh- lich klingender Stimme. „Er gehört mir.“
„Ja, Herr!“
Einer der Wachsoldaten fand Clementes Dolch ganz in der Nähe im Gras liegen. Nachdem er ihn Domenico gereicht hatte, steckte dieser ihn mit finsterem Blick ein.
„Du“, sprach er einen der Männer an. „Geh zum Gou- verneur, und sage ihm, ich möchte ihn sogleich in seinen Räumen aufsuchen. Und du“, wies er einen anderen an, „bringe mir den besten Arzt von Klein-Genua. Und du“, befahl er dem dritten, „kümmerst dich darum, dass meine Kutsche in der nächsten halben Stunde fahrbereit ist.“
Er brauchte Maria. Sobald er dem beschränkten Gou- verneur seine Geschichte erzählt hatte und von einem Arzt behandelt worden war, wollte er zu dem kleinen Land- haus fahren, wo er Maria untergebracht hatte. Sie würde
sich wie immer um seine Bedürfnisse kümmern und ihm Vergnügen bereiten.
Allegra Monteverdi musste sich wegen ihrer Befreiung ganz auf ihren Vater verlassen. Er hatte sein Möglichstes getan.
Dieser schwarzäugige Teufel hat dich in den Hintern getreten, du schniefender Weichling.
Dieser Gedanke quälte ihn, während er sich darum be- mühte, wieder etwas ordentlicher auszusehen. Er klopfte sich die Erde aus den zerknitterten Sachen und fuhr sich mit der linken Hand durch das Haar, während er durch den Palazzo zum Amtszimmer des Gouverneurs hinkte.
Dabei vermied er es, irgendwelchen Ballgästen zu be- gegnen, und warf den gaffenden Dienern böse Blicke zu, um sie einzuschüchtern. Unterdessen brütete er über der Frage, wem der Gouverneur wohl glauben würde, wenn Allegra ihrem Vater erzählte, dass er versucht hatte, etwas Vergnügen mit seiner Tochter zu haben.
Obgleich er natürlich heute Abend nichts Schlimmes getan hatte. Er hatte schließlich nur das Beste für Allegra gewollt – ihre Hochzeitsnacht sollte sie nicht allzu sehr erschrecken. Das musste Monteverdi begreifen. Dome- nico hatte nur versucht, Allegra vor einem unverschämten Rüpel zu schützen.
Wer war wohl dieser Mann? Vermutlich einer der Re- bellen. Aber warum sprach er dann nicht in deren gro- bem Bauerndialekt? Warum hatte er sich als Allegras guten Freund bezeichnet? Der Rohling hatte mit ihr auf so vertraute Weise gescherzt, als wären sie bereits alte Freunde.
Vielleicht hatte er durch die Schläge, die er erhalten hatte, den Verstand verloren. Vielleicht war er auch zu betrunken gewesen, so dass er die Situation nicht rich- tig hatte einschätzen können. Aber Domenico wurde das Gefühl nicht los, dass irgendetwas nicht stimmte.
Wenn Allegra ihm gehorcht und die Wachen gerufen hätte, wie er ihr befohlen hatte, wäre das Ganze niemals geschehen. Zum
Weitere Kostenlose Bücher