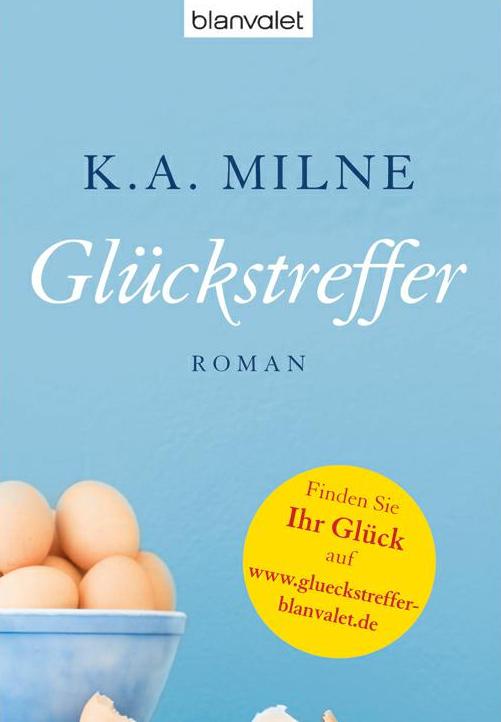![Glueckstreffer - Roman]()
Glueckstreffer - Roman
September habe ich dann die Anzeige in der Lokalzeitung entdeckt, die Deine Hochzeit mit Dr. Garrett Black ankündigte. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, die Ehe bekommt Dir gut. Mein Herz machte vor Freude einen Sprung, als ich das Foto von Euch beiden sah. Dein Lächeln hat mir gezeigt, dass Du einen Weg gefunden hast, mit der Last der Vergangenheit zu leben und mit der Bürde der vermeintlichen Schuld, den Unfall verursacht zu haben, der Deine Familie das Leben gekostet hat.
Es ist traurig, aber wahr: Diese Schuld hätte Dich niemals belasten dürfen. Denn die Schuld für den fatalen Unfall lag ganz allein bei einem Feigling: bei mir.
Mit etwas Glück lernst Du hoffentlich eines Tages meinen Sohn Alex kennen. Wenn Du diesen Brief liest, kannst Du davon ausgehen, dass er es war, der ihn Dir geschickt hat. Er ist die Freude meines Lebens. Leider sind meine Schande und meine Schuld untrennbar mit ihm verbunden. Aber das muss ich genauer erklären.
Alex kam kurz vor Mitternacht am 20. September 1989 zur Welt – also nicht einmal vierundzwanzig Stunden vor besagtem Verkehrsunfall. Seine Mutter, meine Frau Katherine, und ich konnten seine Geburt kaum erwarten. Wir waren beide Anwälte und hatten unsere Familienplanung länger hinausgeschoben als die meisten Paare. Ich war fast fünfundvierzig und meine Frau dreiundvierzig Jahre alt, als sie schwanger wurde. Die Schwangerschaft verlief völlig problemlos, bis die Wehen einsetzten. Ich war mitten in einer Gerichtsverhandlung, als man mich darüber informierte, dass Katherine im Krankenhaus und es bei der Geburt zu Komplikationen gekommen sei. Ich fuhr sofort zu ihr.
Meine Frau bekam während der Presswehen heftige Blutungen. Da das Kind bereits tief im Geburtskanal steckte, mussten die Ärzte zuerst das Kind zur Welt bringen, bevor sie etwas für Katherine tun konnten. Sie arbeiteten, so schnell sie konnten. Schließlich kam Alex auf die Welt, und die Ärzte kümmerten sich um Katherine. Wir waren schrecklich erleichtert, als es gelang, die Blutungen zu stillen und ihren Puls zu stabilisieren, der immer schwächer geworden war.
Die Ärzte führten sofort einige Untersuchungen an Alex durch, doch ich war zu sehr in Sorge um Katherine, um darauf zu achten. Ich nahm an, es handle sich um eine reine Routineangelegenheit. In den folgenden Stunden habe ich am Bett meiner Frau im Krankenhaus gewacht. Sie wurde künstlich beatmet, aber sonst schien alles in Ordnung zu sein. Während ich bei ihr war, sah sie mich plötzlich mit Panik in den Augen an. Sie rang nach Luft, schloss die Augen – und starb. Einfach so. Ohne jeden Abschied. Ohne ein letztes »Ich liebe dich«. Sie hat ihren Sohn nie in den Armen gehalten. Später erfuhr ich, dass sich ein Blutgerinsel in ihrem Gehirn gebildet hatte, das zum Ausfall sämtlicher Organe führte.
Ich muss kaum betonen, dass ich unter einem schweren Schock stand. Den Rest des Tages war ich wie gelähmt, konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe wie in Trance die nötigen Krankenhausformulare ausgefüllt und versucht zu begreifen, was geschehen war. Erst gegen fünf oder sechs Uhr abends hatte ich die erste ruhige Minute, um an unseren Sohn zu denken. Als ich nach ihm fragte, war ich plötzlich von einem Ärzteteam umzingelt. Der Oberarzt der Kinderabteilung erklärte mir, dass unser Kind mit dem Downsyndrom geboren worden war und es daher besondere Pflege und Erziehung benötigte.
Als ich den Begriff »Downsyndrom« hörte, geriet ich wieder in Panik. Und obwohl die Schwestern mich zu überreden versuchten, das Baby in den Arm zu nehmen, lehnte ich ab. Ich war völlig durcheinander. Wie sollte ich ihn in meinen Armen halten – ohne meine Frau? Wie sollte ich ein solches Kind allein großziehen? Ich versank in Selbstmitleid. Warum ausgerechnet ich? Wie unfair und grausam das Leben doch sein konnte! Ich, der ich gerade die Liebe seines Lebens verloren hatte, sollte auch noch die Bürde eines behinderten Kindes tragen?
Ich bin auf diese Gefühle nicht stolz. Aber meine Reue wiegt angesichts dessen, was ich als Nächstes tat, gering.
Ich habe das Krankenhaus einfach verlassen.
Ich habe den Ärzten gesagt, ich könne mich nicht um mein Kind kümmern, und bin einfach hinaus in die regnerische Nacht. Ich war wütend auf alles: auf die Ärzte, weil sie meine Frau hatten sterben lassen; auf meine Frau, weil sie mich allein gelassen hatte; auf die Welt und ihre Ungerechtigkeit; und – absurderweise – auf meinen neugeborenen
Weitere Kostenlose Bücher