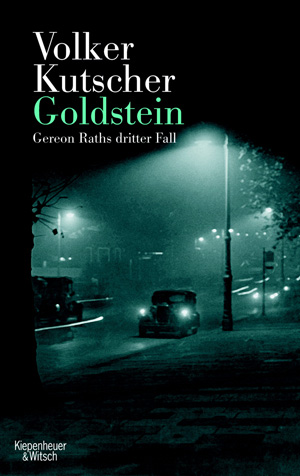![Goldstein]()
Goldstein
einfach so abknallen!
Wenigstens fuhr die Bahn in Richtung Osten. An der Petersburger Straße könnte sie aussteigen und dann zurück zur Wohnung A laufen. Vielleicht würde sie Vicky treffen oder Kotze. Sie brauchte jetzt das Gefühl, wenigstens noch ein paar Freunde zu haben in dieser Stadt.
Als der Uniformierte sie ansprach, ein freundlicher Mann mit weißem Schnurrbart, reagierte sie zunächst mit Achselzucken. Sie war so in Gedanken versunken, sie hatte überhaupt nicht verstanden, was der Mann von ihr wollte.
Bis er seine Bitte wiederholte.
»Den Fahrschein bitte!«
19
E s hatte funktioniert, er war ihnen entwischt. Einen Moment lang hatte er geglaubt, doch verfolgt zu werden, aber dann war der Mann, der an der Kochstraße aus einer Telefonzelle gekommen und ihm bis zur U-Bahn gefolgt war, auf dem Bahnsteig stehen geblieben und nicht eingestiegen. Die ganze Fahrt über hatte erdie Gesichter der U-Bahn-Fahrgäste studiert, um sicherzugehen, dass kein Polizist darunter war. Als er jetzt am Schönhauser Tor die Treppen emporstieg und wieder ans Tageslicht trat, war er endgültig sicher: Nein, da war niemand, der ihn verfolgte. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen und atmete tief und fest, als stünde er in einer leichten Brise am Meer, dabei war es nichts als ordinäre Stadtluft, es roch nach Lindenblüten, Benzin und frischem Asphalt. Wie er das genoss! Endlich wieder frei bewegen! Kein hartnäckiger Detective, der ihm im Nacken saß. Der hockte immer noch im Hotel vor den Aufzügen und glaubte, Abraham Goldstein verbringe den ganzen Tag zeitunglesend und däumchendrehend in seiner Suite. Besser konnte man diese aufdringlichen Cops nicht loswerden, man musste sie nur im Glauben lassen, sie hätten alles unter Kontrolle.
Goldstein warf einen Blick auf den Zettel. Grenadierstraße stand dort, hier irgendwo in der Gegend musste das sein, wenn er sie richtig verstanden hatte. Er schaute sich um, sah Arbeiter auf einem abgesperrten Stück Straße den dampfenden Asphalt verteilen, sah Zeitungsjungen vor einer Eckkneipe mit ihrer Ware wedeln und die Schlagzeilen herunterbeten, sah ein Pferdefuhrwerk um die Ecke rollen, auf der Ladefläche irgendwelches Gemüse unter einer schmutziggrauen Plane. Er überquerte die Fahrbahn und folgte dem Fuhrwerk, das musste die Richtung sein. Und als er das Straßenschild las, wusste er, dass er richtig war.
Die Straße war geschäftig, aber ein wenig heruntergekommen, der Stuck an den Fassaden schmutzigbraun, zum Teil abgebröckelt, aus einigen Fenstern hing Wäsche zum Trocknen. Beinah überall, selbst auf den Gehwegen, wurde Ware angeboten, in den Toreinfahrten standen Händler, und manche verkauften sogar direkt von der Ladefläche ihrer Fuhrwerke, die auf der Fahrbahn standen. Überall erkannte er hebräische Buchstaben und Davidsterne, auf Ladenschildern oder gleich auf die Schaufenster gemalt. So viele jüdische Läden auf einem Haufen hatte er sonst nur in der Lower East Side gesehen, nicht einmal in Williamsburg. Und so viele Kaftanträger. Er war überrascht, damit hatte er nicht gerechnet, das hatte sie ihm nicht gesagt, als sie ihm von dem Laden erzählt und die Adresse aufgeschrieben hatte. Er wusste nicht genau, was für ein Gefühl es war, das er empfand. Verachtung? Oder sogarAbscheu? Er wusste nur, er wollte nichts zu tun haben mit diesen Männern in ihrer düsteren schwarzen Kluft, mit den jungen und ihren dunklen Schläfenlocken noch weniger als mit den weißbärtigen Alten. Er wollte nichts mehr wissen von ihnen und ihrer Welt, die für ihn all das verkörperte, dem er entkommen war. Die Enge ihrer Zweizimmerwohnung, die kranke Mutter, der ewig betende und jammernde Vater, er hatte es gehasst und er hatte es verflucht. Abe, hatte Moe einmal gesagt, du bist ein verdammter Antisemit, ein jüdischer Antisemit, und hatte sein krachendes Lachen dabei hören lassen. Natürlich stimmte das nicht, beides stimmte nicht, er war kein Antisemit, natürlich nicht, und ein richtiger Jude war aus ihm auch nicht geworden. Jedenfalls kein solcher, wie sein Vater ihn sich gewünscht hätte.
Kurz nach seiner Bar Mizwa hatte es angefangen, sein Denken und sein Zweifeln, zu einem Zeitpunkt, als er eigentlich dazugehören sollte, sich stattdessen immer mehr abgewandt hatte vom Gott seiner Väter und von ihrer Welt. Oder war es die Krankheit seiner Mutter, die ihn zu Moe unter die Brücke getrieben hatte? Vielleicht auch erst ihr Tod? So genau wusste er das nicht mehr. Er
Weitere Kostenlose Bücher