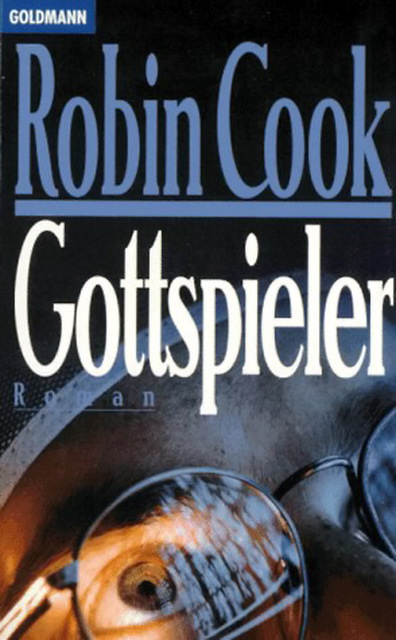![Gottspieler]()
Gottspieler
schätzen!«
»Keine Ursache«, sagte Clark und erhob sich von dem Metallstuhl, den er sich an Jeoffry Washingtons Bett gerückthatte. Er hob die Hand und wartete, bis Jeoffry die seine ausgestreckt hatte, ehe er freundschaftlich einschlug.
»Und wann kommst du endlich hier raus, Mann?« fragte er.
»Bald, schätze ich. Vielleicht in ein paar Tagen. Ich bin nicht ganz sicher. Sie verpassen mir immer noch diese Infusionen.« Jeoffry hob den linken Arm und deutete auf den gewundenen Plastikschlauch. »Gleich nach der Operation hatte ich eine Entzündung in den Beinen. Zumindest hat Dr. Sherman das behauptet. Also haben sie mir Antibiotika verabreicht. Ein paar Tage lang ging’s mir verdammt schlecht, aber jetzt fühle ich mich schon wieder besser. Das Beste, was mir bisher passierte, war, daß sie den verdammten Herzmonitor rausgeschafft haben. Ich sage dir, das Piepsen von der Mutter hat mich einfach verrückt gemacht.«
»Wie lange liegst du eigentlich schon hier?«
»Neun Tage.«
»Das ist doch gar nicht so schlimm.«
»Von diesem Ende aus betrachtet nicht. Aber ich kann dir sagen, am Anfang hatte ich ganz schön Schiß. Na ja, ich konnte es mir nicht aussuchen. Sie haben mir gesagt, daß ich sterben würde, wenn ich mich nicht operieren ließe. Was soll man da schon machen?«
»Nichts! Ich seh’ dich morgen abend und bring’ dir die Bücher mit, die du haben wolltest. Sonst noch was?«
»Wie wär’s mit ’n bißchen Gras?«
»Du spinnst wohl, was?«
»Hab nur ’n Witz gemacht.«
Clark winkte Jeoffry von der Tür aus noch einmal zu, ehe er sich umdrehte und den Gang entlangging.
Jeoffry blickte sich in seinem Zimmer um. Er war froh, daß er hier bald herauskam. Das andere Bett war leer. Sein Zimmergenosse war heute morgen entlassen worden, und noch hatten sie keinen neuen dazugelegt. Jeoffry litt ein wenig darunter, so allein zu sein, besonders jetzt, nachdem Clark gegangenwar und es nichts mehr gab, worauf er sich freuen konnte. Jeoffrys Meinung nach war ein Krankenhaus kein Ort, wo man einen Menschen allein lassen sollte. Es gab zu viele beängstigende Prozeduren, denen man sich unterziehen mußte, und zu viele seelenlose Maschinen.
Jeoffry schaltete den Miniaturfernseher an, der am Fußende des Betts stand. Etwa gegen Ende der zweiten Comedy-Show erschien Miss De Vries, die schwammige Nachtschwester. Sie tat so, als hätte sie etwas Leckeres für ihn zu essen, und verlangte, daß er die Augen schloß und den Mund öffnete. Er gehorchte, wobei ihm ziemlich klar war, worauf der ganze Zauber hinauslief, und natürlich hatte er recht: Es war ein Thermometer.
Zehn Minuten später kehrte sie zurück, nahm das Thermometer wieder an sich und verabreichte ihm dafür eine Schlaftablette. Er nahm die Tablette und spülte sie mit Wasser aus einem Glas vom Nachttisch neben dem Bett hinunter, während die Schwester das Thermometer ablas.
»Habe ich Temperatur?« fragte Jeoffry.
»Jeder hat Temperatur«, sagte Miss De Vries.
»Wie konnte ich das nur vergessen«, seufzte Jeoffry, denn er hatte diese Antwort nicht zum erstenmal erhalten. »Also gut, habe ich Fieber?«
»Ich bin nicht befugt, diese Frage zu beantworten«, sagte Miss De Vries.
Jeoffry konnte nie verstehen, warum die Schwestern ihm nicht sagen wollten, ob er Temperatur – Pardon, Fieber – hatte oder nicht. Immer sagten sie, das müsse der Doktor entscheiden, was absolut verrückt war. Schließlich handelte es sich um seinen Körper.
»Was ist mit diesem Infusionsschlauch hier?« fragte Jeoffry, als die Schwester sich wieder zurückziehen wollte. »Wann kommt der endlich heraus, damit ich mal wieder richtig duschen kann?«
»Darüber weiß ich nichts.« Sie winkte ihm zu, bevor sie verschwand.
Jeoffry verdrehte den Kopf und blickte zu der IV-Flasche hinauf. Einen Moment lang beobachtete er den regelmäßigen Fall der Tropfen in die kleine Kammer. Er seufzte und wandte sich wieder dem Fernsehapparat und den Abendnachrichten zu. Es würde eine echte Erleichterung sein, wenn sie ihm diese Leine endlich abnahmen.
Als das Telefon zum erstenmal klingelte, fuhr Thomas hoch und wußte einen Herzschlag lang nicht, wo er sich befand. Beim zweiten Klingeln drehte sich Doris zu ihm um und fragte: »Willst du drangehen, oder soll ich?« Ihre Stimme war heiser vom Schlaf. Sie stützte sich auf den linken Ellenbogen.
Thomas betrachtete sie im Halbdunkel. Sie sah grotesk aus mit ihrem dicken Haar, das vom Kopf abstand, als hätte man ihr einen
Weitere Kostenlose Bücher