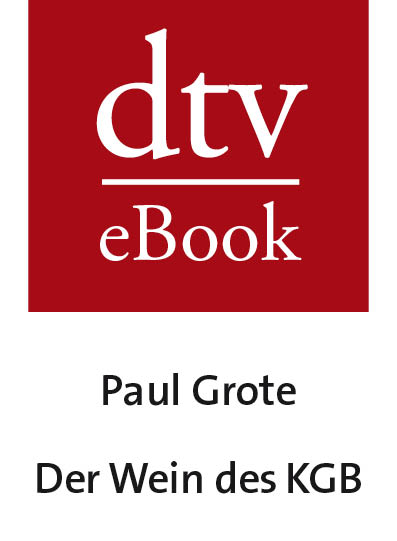![Grote, P]()
Grote, P
von Miriam Vasilescu. Dazu benötigte er eine Dreiviertelstunde über Treppen, durch Flure, breite Korridore und Hinterhöfe, dann stand er in einem winzigen Raum, der bis unter die Decke mit Büchern, Zeitschriften und Mappen mit Zeitungsausschnitten vollgestopft war. Für die Dozentin, ihren Schreibtisch und den Stuhl blieben vielleicht zwei Quadratmeter übrig.
Sie war eine kleine und drahtige Frau, sie sah nach einer Kratzbürste aus und legte weder Wert auf Frisur noch auf Kleidung. Rock und Pullover stammten wohl aus einer Altkleidersammlung, ihre Brille aus einer Dritte-Welt-Aktion. Deshalb wirkten ihre hochhackigen Pumps, ohne die sie bedeutend kleiner gewesen wäre, wie ein Stilbruch. »Wollen Sie französisch oder englisch sprechen? Lieber griechisch oder deutsch?«
Dumm war sie nicht und auch nicht unfreundlich, Martin war mittlerweile einiges gewohnt, und nach einigenWorten auf Deutsch entschied er sich für Französisch, es war ihm lieb und am geläufigsten.
Die Dozentin erinnerte Martin an einen Specht, mit den großen Augen und einem Schnabel wie eine Spitzhacke. Sie hämmerte sofort mit ihren Fragen auf ihn ein. »Sie wollen hier Weinberge kaufen? Für wen? Welche Rebsorten wollen Sie pflanzen? Werden Sie eine Kellerei übernehmen oder eine neue bauen? Wie wird das finanziert, und welche Bank steckt dahinter? Wie viel wollen Sie investieren? Wird es ein Joint Venture, also rumänisch-ausländisch – oder wollen Sie uns gleich unser Land wegnehmen? Werden Sie Ihre Mitarbeiter mitbringen oder Rumänen ausbilden? Zahlen Sie die gleichen Hungerlöhne wie alle Transnationalen? Wenn Sie meinen, Sie können mit uns umgehen wie mit chinesischen Saisonarbeitern, sind Sie bei mir absolut an der falschen Adresse. Wenn Sie sich von mir irgendwelche Vergünstigungen erwarten oder Beziehungen zu sogenannten einflussreichen Persönlichkeiten, dann weiß ich nicht, weshalb Lucien Sie geschickt hat . . .«
Martin sackte unter dem Wortschwall zusammen, er war sich nicht einmal klar darüber, wie er die erste Frage beantworten sollte, da fragte sie schon weiter. »Werden Sie für den heimischen Markt produzieren, oder wollen Sie exportieren? Wo werden Sie die Bodenanalysen machen lassen, bei uns? In Deutschland . . .?«
So ging es weiter. Je mehr Fragen sie allerdings stellte, desto mehr Respekt gewann sie in seinen Augen, und irgendwann lächelte Martin sie an. »Ich finde, Sie sind großartig! Arbeiten wir zusammen?«
Mit dieser Wendung hatte der Specht nicht gerechnet, der Abwehrplan war nicht aufgegangen. Der Kopf mit dem Schnabel blieb nach vorn gereckt stehen, als hätte man ihm plötzlich den Baum weggezogen.
»Das alles möchte ich gern mit Ihnen besprechen. Deshalb bin ich hier.«
»Lassen Sie mich noch diesen Satz zu Ende schreiben.« Sie wies auf den Bildschirm. »Und dann laden Sie mich zum Kaffee ein. In der Cafeteria gibt es einen traumhaften Nusskuchen. Den backt eine der Köchinnen und verkauft ihn – wie alle – unter der Hand. Bei diesen Hungerlöhnen ist jeder auf Nebenverdienste angewiesen.«
»Die Höhe der Löhne ist wahrscheinlich relativ«, sagte Martin, betrachtete die Papierberge und sah sich vergebens nach einer Sitzgelegenheit um.
»Eben, wie alles. Wenn man ganz unten ist, fängt das Kleine bereits hoch oben an. Ich merke, wir verstehen uns.« Sie stand auf und warf sicherheitshalber noch einen Blick in die Runde, aus Furcht, dass einer ihrer Stalagmiten beim Öffnen der Tür ins Rutschen kommen könnte. Beruhigt wandte sie sich ab. »Wenn niemand auf die Idee kommt, das Fenster aufzumachen, und uns kein Erdbeben erschüttert, bleibt alles liegen.«
Sie war eine Studienkollegin von Lucien, wie sie erzählte, und teilte seine politischen Ansichten. Von Sofias »Unfall« hatte sie bereits einen Tag später erfahren und war wie Lucien der Meinung, dass man Sofia beseitigt hatte. Sie zweifelte keine Sekunde daran. »Das hat man früher so gemacht, das macht man heute so, und das wird morgen wieder geschehen.«
»Sie glauben, dass sich nichts ändern wird?«
»Dazu müsste der Mensch sich ändern, und das tut er nicht, das kann er nicht, er ist wie er ist – von seiner Natur her. Also muss man versuchen, eine Art Gleichgewicht zu schaffen, einen Gegenpol zu bilden, den gibt es auch. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Habgier und Verantwortung, Lüge und Wahrheit. Darin sehe ich meine Aufgabe.«
»Ist das nicht gefährlich?«
»Es gab schon gefährlichere Zeiten.
Weitere Kostenlose Bücher