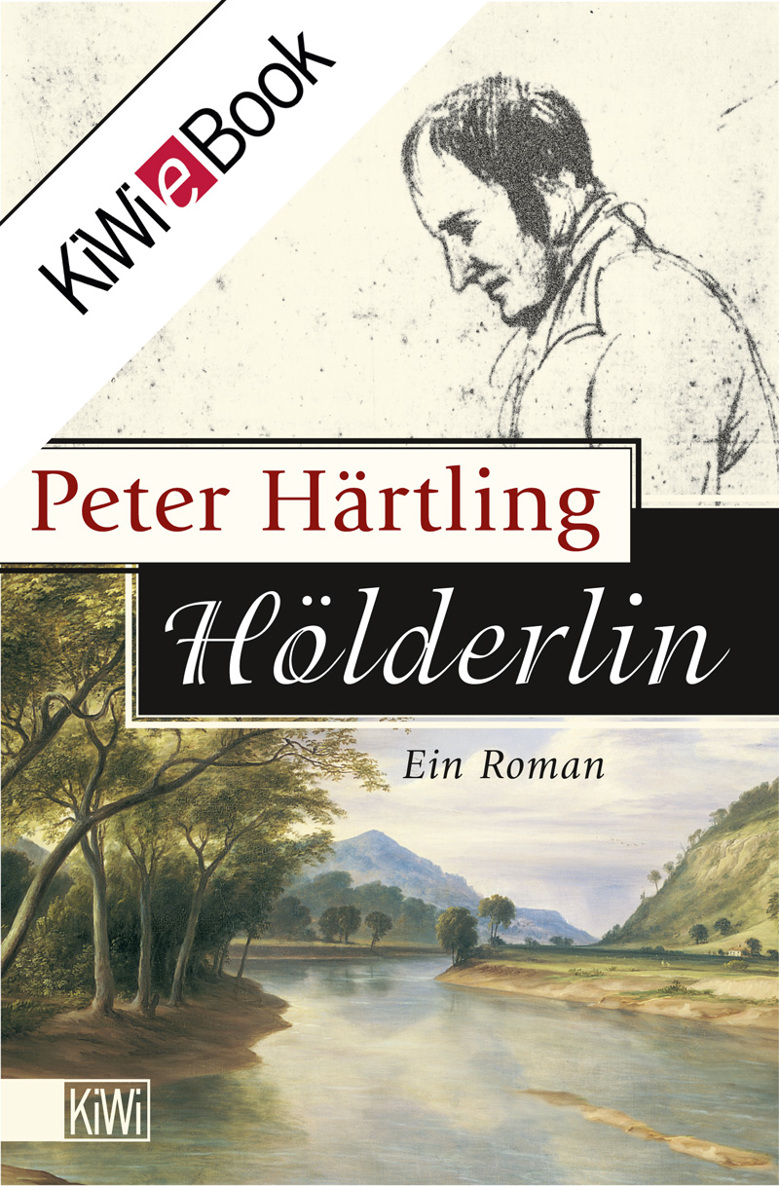![Härtling, Peter]()
Härtling, Peter
sich endlich die Seele sagt – du kannst nichts mehr verlieren – aber leider wirst du noch leiden!« So hat Charlotte von Kalb geredet, diese huschenden, sich verhaspelnden Gedanken. Er antwortet ihr nicht. Mit Siegfried Schmid, dem Friedberger, um dessentwillen er sich mit Böhlendorff und Sinclair angelegt hatte, korrespondiert er dagegen fleißig. Schmidsungebrochener Enthusiasmus tut ihm gut, da kann er herzlich antworten.
Charlottes unvermuteter Brief hat ihm dennoch ein Stichwort gegeben: Jena. Könnte er dort nicht Vorlesungen halten? Könnten ihm Schiller und Niethammer nicht behilflich sein? Er bittet beide, schlägt sich als Dozent für griechische Literatur vor, »ich glaube, im Stande zu sein, Jüngeren, die sich dafür interessieren, besonders damit nützlich zu werden, daß ich sie vom Dienst des griechischen Buchstabens befreie und ihnen die große Bestimmtheit dieser Schriftsteller als eine Folge ihrer Geistesfülle zu verstehen gebe«. Es ist sein letzter Versuch, mit Schiller wieder Verbindung aufzunehmen. Schiller antwortet nicht. Die tatsächlichen oder eingebildeten Verankerungen beginnen eine nach der anderen zu reißen.
Eine andere Aussicht, neu zu beginnen, Bestätigung zu finden, zerschlägt sich ebenfalls: Huber, dem Redakteur der »Allgemeinen Zeitung«, den er von Landauer kannte, war es gelungen, Cotta für Hölderlins Gedichte zu interessieren. Cotta ist bereit, einen Band in tausend Exemplaren und zu einem Honorar von neun Gulden für den Bogen zu verlegen. Hölderlin macht sich Hoffnungen, sammelt die Gedichte.
Dann kommt es doch nicht dazu.
Er kann nicht bleiben, ihn hält nichts mehr.
Du bisch krank, Fritz, du kannsch net weg.
I woiß ja au net wohin.
Du darfst nicht weg.
Professor Ströhlin, den Landauer über Hölderlins Stellungssuche unterrichtet hat, bietet den Ausweg. Hölderlin könne bei dem Hamburger Konsul in Bordeaux, Daniel Christoph Meyer, eine Stelle antreten. Außer einem Jahresgehalt von fünfzig Louisd’ors biete Meyer noch fünfundzwanzig Louisd’ors Reisegeld.
Die letzte Wartezeit ist zu Ende. Hölderlin kann, ein triftiges Ziel vorweisend, aufbrechen. Am 10. Dezember 1801 beginnt er seine Wanderung. Wieder flieht er in den Winter hinein. Die drei Frauen begleiten ihn bis Neckarhausen, winken ihm, weinend und ohne Verständnis für diese Trennung, nach.
Von Böhlendorff, der ihm seine dramatische Idylle »Fernando und die Kunstweihe« zur kritischen Lektüre geschickt hatte, verabschiedet er sich: »Dein Fernando hat mir die Brust um ein gutes erleichtert. Der Fortschritt meiner Freunde ist mir so ein gutes Zeichen. Wir haben Ein Schicksal.« Das ist wahr. Es wird ihnen beiden nicht gelingen, »vernünftig« mit dem Leben zurechtzukommen. »Und nun leb wohl, mein Teurer! bis auf weiteres. Ich bin jetzt voll Abschieds. Ich habe lange nicht geweint. Aber es hat mich bittre Tränen gekostet, da ich mich entschloß, mein Vaterland noch jetzt zu verlassen, vielleicht auf immer. Denn was habe ich Lieberes auf der Welt? Aber sie können mich nicht brauchen.«
[ Menü ]
Siebter Teil
Die letzte Geschichte
Bordeaux, Nürtingen, Homburg
(1802–1806)
[ Menü ]
I
In Straßburg halten ihn die Behörden lange auf. Sie müssen ihn, als Ausländer, überprüfen. Seine Papiere sind in Ordnung. Er wartet. Es ist kalt. Er muß sparen. Er hat sich in einer billigen Herberge ein Zimmer genommen. Die ganze Zeit friert er. Nach zehn Tagen wird ihm Bescheid gegeben. Er dürfe reisen, jedoch nicht über Paris. Bis Besançon nimmt er die Post, über Kolmar und Belfort. Auf diesen Strecken gibt es noch regelmäßigen Postverkehr. Im Landesinnern sei er weitgehend zusammengebrochen. Auf Anraten eines französischen Beamten, den er in seinem Gasthof kennengelernt hatte, und der sich auf dem Rückweg von Mainz in die Heimat befand, hatte Hölderlin sich eine Pistole gekauft. Im Gebirge trieben sich noch immer versprengte Royalisten und Banditen herum, die den Ärmsten die letzte Habe raubten. Hölderlin solle sich vorsehen. Nun befand er sich in der Republik. Aber darüber redete kaum einer. Es störte ihn, daß es fast jeder vermied, über Politik zu sprechen.
In Besançon fragte er vergebens nach einem Wagen. Die Landschaft drängte sich mit schroffen Bergen vor seinen Augen, wiederholte sich. Sah er von weitem Menschen, machte er einen Umweg. Es war feucht, kalt, mitunter schneite es, die schmutzig grauen Wolken zogen tief. Oft wußte er nicht, ob er den richtigen Weg
Weitere Kostenlose Bücher