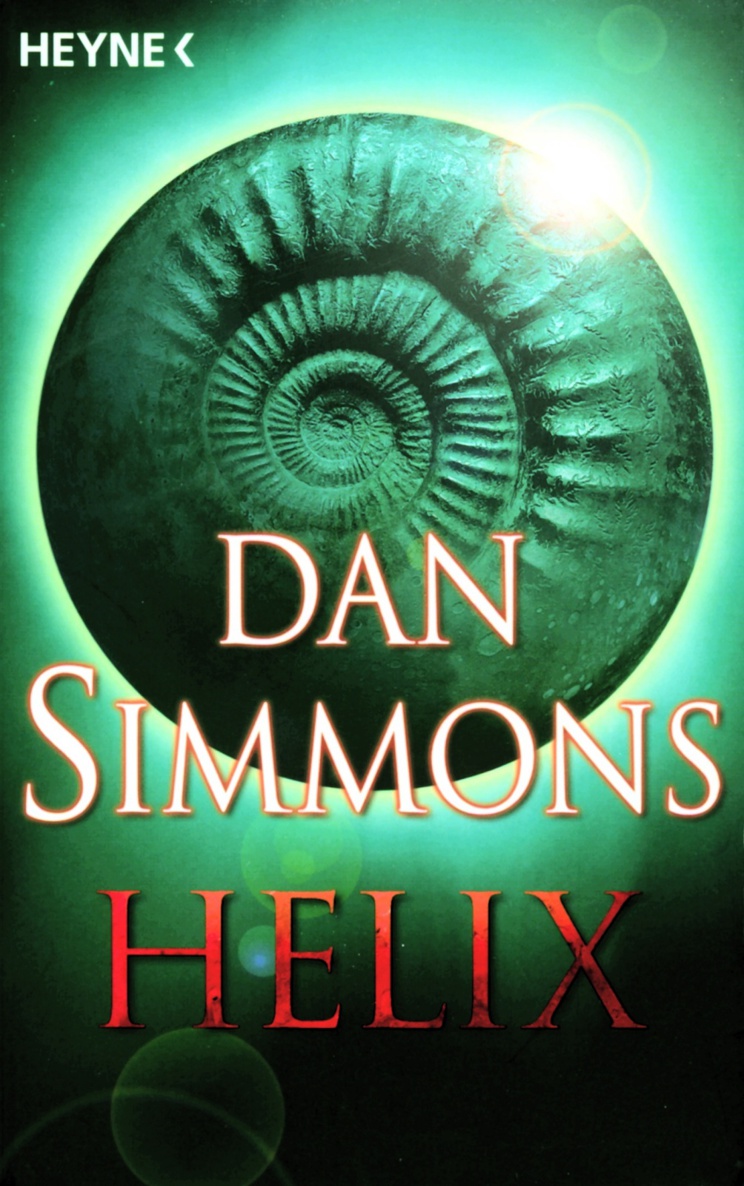![Helix]()
Helix
seiner Werke es uns zu zeigen scheinen? War er bisexuell, wie man möglicherweise seinen Sonetten entnehmen kann?
Warum rede ich überhaupt über Shakespeare? Oder über Stephen King?
Ich kann wirklich nicht behaupten, mit ihnen auf Du und Du zu stehen, aber ich bin in der gleichen Gewerkschaft organisiert wie sie. Unsere Fähigkeiten mögen Lichtjahre auseinanderliegen, doch wir drei beschäftigen uns mit den gleichen Dingen. Früher oder später – früher für uns, später für diejenigen, die unsere Werke lesen, wenn wir tot sind (obwohl nur wenige Autoren auch nach ihrem Tod noch gelesen werden) – werden diejenigen, die nach uns Ausschau halten, in den Gezeitentümpeln aus Energie suchen müssen, die wir in unseren Figuren hinterlassen haben.
Während ich diese Zeilen in den ersten Monaten des 21. Jahrhunderts schreibe, wird die knirschende Maschinerie der akademischen Kritik von den toten Händen einiger französischer Winzlinge in Gang gehalten, wie etwa Michel Foucault und Jacques Derrida. Frankreich – eine Nation, die uns im ganzen 20. Jahrhundert keine großen Autoren und keine große Literatur geschenkt hat – beherrscht dennoch die Diskussion über die Literatur zu Beginn des 21. Jahrhunderts, und zwar mittels der spitzfindigen Idee, die zentrale Bedeutung der Autoren, die Realität der Figuren und die transzendente Kraft der Sprache und der Literatur selbst zu verleugnen. Wie Tom Wolfe unlängst in einem Essay über Foucault und Derrida und ihre Legionen sagte: »Sie begannen mit der Überzeichnung der Aussage von Nietzsche, dass es keine absolute Wahrheit geben könne, sondern nur ›Wahrheiten‹, die bloße Werkzeuge verschiedener Gruppen, Klassen oder Kräfte seien. Von dort aus gelangten die Dekonstruktivisten zu der Doktrin, dass die Sprache das heimtückischste aller Werkzeuge sei. Die Pflicht des Philosophen bestehe darin, die Sprache zu dekonstruieren, ihre heimlichen Agenden aufzudecken und den Opfern des amerikanischen ›Establishment‹ zu helfen: den Frauen, den Armen, den Nichtweißen, den Homosexuellen, den Hartholzbäumen.«
Shakespeare hat uns keine bestimmte Meinung zu Hartholzbäumen hinterlassen (auch wenn seine schönsten Späße wie »Ein Mittsommernachtstraum« in dunklen, tiefen Wäldern spielen). Er hinterließ uns allerdings ein Gefühl für sein einzigartiges Bewusstsein, seine intellektuellen Neigungen und seine menschlichen Gelüste – aufgespeichert in den Zeitkapseln seiner Stücke wie ein Spiegel mit vielen Facetten, der uns einen Einblick in das menschliche Potenzial namens Hamlet und Jago und Falstaff, Cleopatra und Rosalind und Lear gibt.
Meine eigenen Figuren, die nur mir selbst lieb und teuer sind, sind, was Wesen und Intensität betrifft, vermutlich erheblich unschärfer gezeichnet, und doch spielen sie für mich eine zentrale Rolle. Ihre Deformationen sind einander ähnlich, und der brüchige Spiegel meiner Erfindungen zeigt mir Menschen – nun gut, Romanfiguren sind keine Menschen, aber andererseits auch mehr als bloße Worte oder die verausgabten sozialen Energien, die Foucault als Ersatz für das Menschliche vorschlug –, dieser brüchige Spiegel also zeigt mir Figuren, die Richard Baedeker und Melanie Fuller, Joe Lucas und Jeremy Bremen und Duane McBride und Cordie Cooke, Paul Dure, Raul Endymion und Aenea, Dale Stewart und Robert C. Luczak heißen.
Und jetzt also Norman Roth.
Samuel Johnson nannte einmal ein einfaches Rezept für klares Denken, das ebenso gut für den klaren Blick funktioniert: »Zuerst verbanne jedes ›Es geht nicht‹ aus deinem Geist.«
Was Norman Roth in »Das Ende der Schwerkraft« sieht, was er zu sehen versucht, was er nicht sehen kann und was er dank seiner Intuition doch als die Wahrheit erkennt, obwohl er es nicht zu erblicken vermag, ist vielleicht keine zwingende Vision im strengen Sinne, aber es ist der Versuch eines sterbenden Mannes am Ende einer kurzen Ära der Menschheit, einen klaren Blick zu bekommen. Es ist Rembrandts scharfer Blick über Welten und Zeiten hinweg, der Blick für das Ganze.
»Ganzheit; alles andere ist Öde und Trostlosigkeit.«
Achtunddreißigtausend Fuß über dem Eis des Nordpols träumt Norman Roth vom Schweben.
Er ist vier oder höchstens fünf Jahre alt, und sein Vater lehrt ihn nahe bei ihrem gemieteten Sommerhaus auf Long Island im Meer das Schwimmen. Roth treibt im Salzwasser auf dem Rücken und bemüht sich, entspannt in den Armen seines Vaters zu ruhen. Die Wellen brechen sich
Weitere Kostenlose Bücher