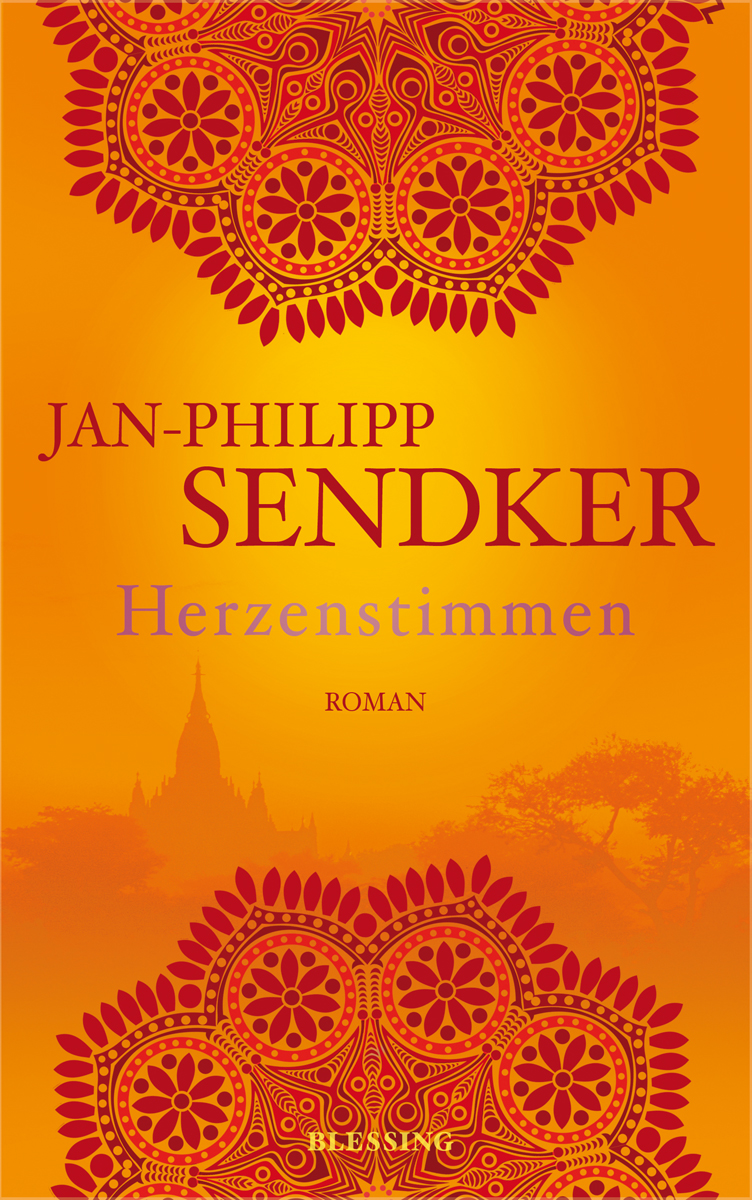![Herzenstimmen]()
Herzenstimmen
schliefen in einer Baracke auf Pritschen, im Winter bekamen wir sogar ein paar Decken, die wir uns teilten.
Thar Thar genoss schnell ein gewisses Ansehen, denn er war ein außergewöhnlich guter Koch. Seine Spezialität war ein süßer Reiskuchen. Ich vermutete, wir entgingen dem Abtransport an die Front nur, weil die Offiziere nicht aufThar Thars Essen verzichten wollten.
Mein Überleben hing von seinem ab. Ich bemühte mich, ein unersetzlicher Assistent zu sein, putzte, schälte und schnitt Gemüse, kochte Reis, schlachtete Hühner, wenn die höheren Offiziere mal nach Fleisch verlangten.
Ich glaube, Thar Thar war einigen mit der Zeit unheimlich geworden. Er sprach in den zwei Jahren kaum mehr als ein paar Sätze. Er machte still seine Arbeit, egal was sie ihm auftrugen, antwortete mit Nicken oder Kopfschütteln, hielt sich aus allen Gesprächen heraus. Er lachte nicht über Späße, gin gen sie auf seine Kosten, ignorierte er sie. Auf Drohungen reagierte er überhaupt nicht. Einem Kommandanten, der ihm ins Gesicht schlug und drohte, ihn am nächsten Tag an die Front zu schicken, weil das Essen nicht pünktlich fertig war, schaute er so lange wortlos in die Augen, bis der sich unsicher abwandte.
Manche hielten ihn wegen seiner Furchtlosigkeit für einfältig, andere wegen seiner Schweigsamkeit für stumm. Ich wusste, dass er beides nicht war, und bewunderte ihn bereits da für seinen Mut, ohne zu ahnen, was noch kommen sollte. Thar Thar war der tapferste Mensch, dem ich je begegnet bin.
Selbst wenn er sich verletzte, sagte er nichts. Einmal kippte ein Topf mit siedendem Wasser um, es lief ihm über die Beine, doch er zuckte nur kurz. Betrachtete die verbrannte Haut, als gehöre sie jemand anderem.
In unserem Quartier standen die Pritschen so dicht, dass wir das Magenknurren des anderen vernahmen. Im ersten Jahr hörte ich ihn nachts hin und wieder weinen. Manchmal griff er in der Dunkelheit nach meiner Hand, umklammerte sie so fest, dass es schmerzte. Er ließ sie lange nicht los.
Wenn ich ihn fragte, ob ich etwas für ihn tun könnte, antwortete er immer: »Nein. Danke.«
Danke.
Ich hatte fast vergessen, dass es das Wort gab.
Nur der Schlaf löste seine Zunge. In der Nacht rief er nach seiner Mutter oder seinem Vater. Oder stammelte Sätze, von denen ich nur Bruchstücke verstand.
Ich wollte ihn immer fragen, was in der Nacht geschehen war, in der seine Mutter Ko Gyi holen kam, habe mich das aber nie getraut.
Als das Militär eine große Offensive gegen die Rebellen vor bereitete, mussten auch Thar Thar und ich in den Dschungel.
Zu dem Zeitpunkt hatten wir von den Soldaten genug Geschichten gehört, um zu wissen, dass es für uns so gut wie keine Chance gab, lebend zurückzukehren. Meine Angst fraß mich auf. In den Tagen vor unserem Abtransport konnte ich ihm nicht in der Küche helfen, weil ich Durchfall hatte und kotzte. Bei Thar Thar dagegen merkte ich keine Veränderung. Ich ahnte schon damals, was sich im Dschungel bestätigte: Es war ihm egal. Er fürchtete sich weder vor dem Tod noch vor dem Sterben. Ich habe erst viel später erfahren, wovor er sich wirklich fürchtete.
Als es dann so weit war, pferchten uns die Soldaten auf zwei offene Lastwagen, wir fuhren den ganzen Tag ohne Pause, bis wir am späten Abend ein Basislager erreichten, in dem ein Regiment stationiert war. Von dort brachen wir in kleineren Einheiten zu tagelangen, manchmal wochenlangen Märschen in den Dschungel auf.
In dem Lager herrschte eine ganz andere Atmosphäre als in der Kaserne. Die Soldaten waren nervös und aggressiv, sie traten und schlugen uns ohne Grund. Wären wir Lasttiere gewesen, hätten sie uns besser behandelt. In der Nacht erwachten wir von Schüssen, die die Wachen in die Dunkelheit feuerten, weil sie einen Angriff der Rebellen fürchteten.
Wir schliefen in Bambushütten auf der Erde. Toiletten gab es für uns nicht, wir mussten in eine Ecke hinter der Hütte gehen, wo sich die Scheiße häufte. Abends und morgens fielen die Mücken über uns her, wer noch nicht an Malaria litt, steckte sich in kürzester Zeit an.
Zu essen gab es wenig, fast ausschließlich Reis, etwas Gemüse, gelegentlich ein Stück Trockenfisch. Schlimmer als der Hunger war der Durst. Trinkwasser war rationiert, wir bekamen, was übrig blieb. Nicht viel. Medikamente gab es nur für Soldaten. Wenn einer von uns ernsthaft krank wurde, eiternde Wunden, schwere Malaria, Lungenentzündung, Schlangenbisse, brachten sie ihn in eine Hütte
Weitere Kostenlose Bücher