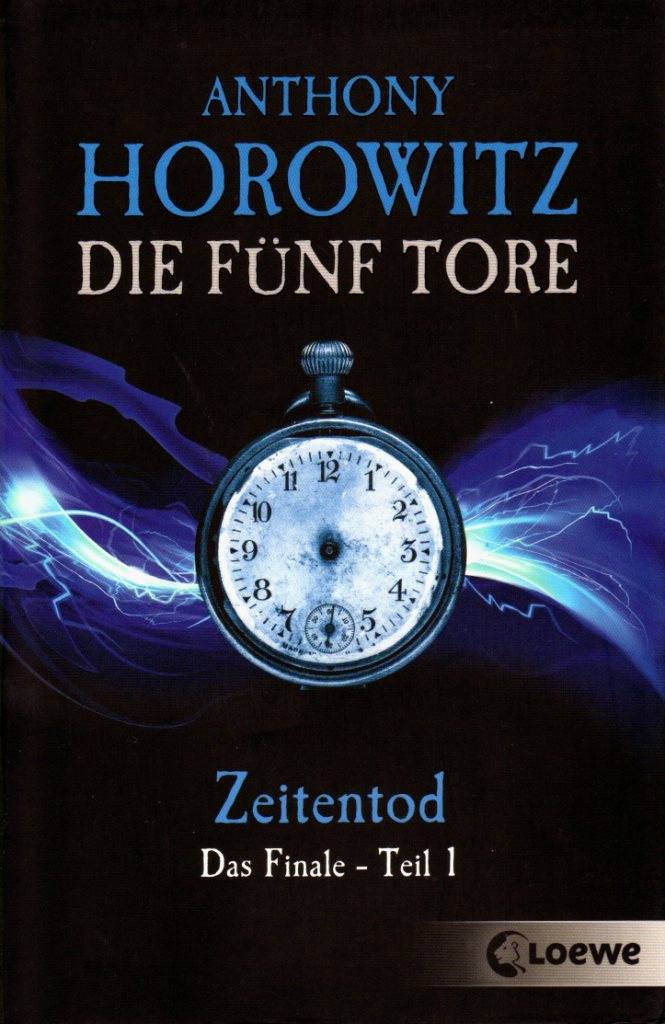![Horowitz, Anthony - Die fuenf Tore 5 - Zeitentod (Das Finale - Teil 1)]()
Horowitz, Anthony - Die fuenf Tore 5 - Zeitentod (Das Finale - Teil 1)
Anfang eines langen Prozesses gewesen war, dass sie Tag für Tag zurückkehren und ihn langsam umbringen würden, indem sie ihm einen Knochen nach dem anderen brachen. Aber sie waren nicht zurückgekommen – außer um ihm die paar Brocken zu bringen, die sein Essen sein sollten, und um ihn zur Toilette, zum Duschen und die tägliche Stunde auf den Hof zu führen. Inzwischen waren weitere vierundzwanzig Stunden vergangen, doch für Pedro hatte die Zeit ihre Bedeutung verloren. Es war, als hätte der Angriff niemals stattgefunden.
Er hatte nichts von Scott gehört. In vieler Hinsicht machte er sich um ihn mehr Sorgen als um sich selbst. Er wusste, was Scott in der Vergangenheit durchgemacht hatte, und bezweifelte, dass er noch viel mehr ertragen konnte. Pedro war klar, dass er keine große Hilfe gewesen war und dass eine starke Spannung zwischen ihnen geherrscht hatte, aber er war trotzdem überzeugt, dass sie zusammen besser dran gewesen waren. Wenigstens hatten sie miteinander reden können.
In der Traumwelt hatte er immer noch keine Spur von den anderen gefunden. Pedro landete jedes Mal dort, wenn er schlief, und hasste es, so allein zu sein. Er lief immer weiter in der Hoffnung, irgendjemanden oder irgendetwas zu begegnen, aber alles, was er bisher gesehen hatte, war der Riesenbaum, der jetzt weit hinter ihm lag und dessen Blätter am Horizont in alle Richtungen ragten und den Himmel beherrschten. Er war froh, von ihm wegzukommen. Obwohl er nicht wusste, was der Baum zu bedeuten hatte, spürte er doch, dass er gefährlich war und ihn mahnte, sich zu entfernen.
Ihn mahnte zu verschwinden, solange er es noch konnte.
Pedro war ganz einfach zu diesem Schluss gekommen. Wenn er noch viel länger in dieser Zelle blieb, würde er nicht mehr die Kraft für eine Flucht haben. Er war daran gewöhnt zu hungern. Er war in Armut geboren worden, in der Provinz Canta in der Nähe von Lima. Dort hatte es nie genügend Essen für alle gegeben und was da war, hatten sich natürlich die Männer genommen. Aber als er in die Stadt gegangen war, wurde alles noch schlimmer. Er hatte auf der Straße gelebt und gegessen, was er stehlen konnte oder in den Mülltonnen der wohlhabenden Vorstädte fand. Es hatte ihn nie gestört, das kalte geronnene Fett zu verschlingen, das vom Teller irgendeines reichen Mannes gekratzt worden war. Er musste überleben. So war das eben.
Aber jetzt war die Lage anders. Er war wie ein Tier in einem Käfig, dem man nicht nur das Essen genommen hatte, sondern auch jede Hoffnung. Mit jedem Tag, der verging, akzeptierte er sein Schicksal ein wenig mehr, die eine Stunde Hofgang und die endlosen Stunden, die er allein verbrachte. Sogar als sie ihm den Finger gebrochen hatten, hatte er sich kaum gewehrt. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da hätte er noch gebissen, gekratzt, getreten und alles getan, um sich zu schützen, doch diesmal war er zu langsam gewesen. Das war es, was ihm Angst machte. Er starb jeden Tag ein bisschen mehr.
Einen Vorteil hatte er jedoch. Sie hielten ihn für ein Nichts. Sie sahen in ihm nur einen kleinen unterernährten Jungen, der nicht einmal ihre Sprache sprach und sich vermutlich jede Nacht in den Schlaf weinte. Ein Spinnenbein. Eines wussten sie aber nicht, konnten es nicht wissen – dass er zwei Jahre in Lima überlebt hatte, einer der gefährlichsten Städte Südamerikas. Er hatte in einem Slum gewohnt, sich einen kleinen Raum mit einem Dutzend anderer Jungen geteilt, die ihn für einen einzigen Dollar abgestochen hätten. Es hatte noch andere Gefahren gegeben – die Polizei, rivalisierende Banden, Kriminelle, die ihre kleinen Reviere kontrollierten, reiche Männer, die versuchten, einen ins Auto zu zerren, um dann Dinge zu tun, an die man lieber nicht denken wollte. Um ohne Geld in Lima zu überleben, musste man stark sein, und Pedro besaß Stärken, von denen die Wachen keine Ahnung hatten.
Auszubrechen war nicht das Problem. Pedro wusste, dass er im Keller – dem Kerker – irgendeiner Burg war und dass sie sich mitten in einer Stadt befand. Er hatte gehört, wie Leute vorbeikamen – kein Verkehrslärm, weil es keine Autos gab, aber das dumpfe Murmeln von großen Menschenmengen, gelegentlich unterbrochen vom Schrillen einer Polizeipfeife. Es schien ziemlich viel Polizei unterwegs zu sein. Er befand sich auch in der Nähe einer Küche. Je verhungerter er war, desto schärfer wurde sein Geruchssinn, und er hätte alles benennen können, was in der letzten Woche in dieser
Weitere Kostenlose Bücher