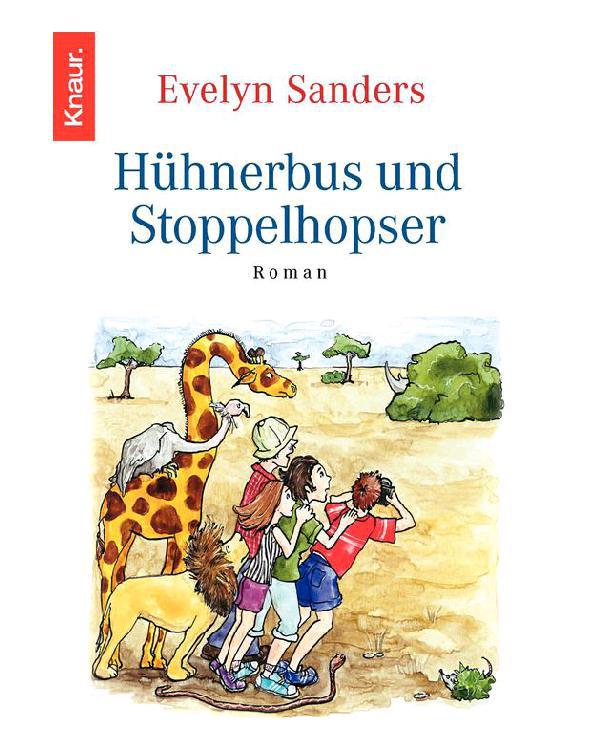![Hühnerbus und Stoppelhopser (German Edition)]()
Hühnerbus und Stoppelhopser (German Edition)
Platz übriggeblieben war, hatte man mit Stühlen vollgestellt. Zwei standen an der Wand, die anderen direkt vor den Betten. Das seien aber nicht ihre eigenen Stühle, erzählte William unbekümmert, Nachbarn hätten sie geliehen, damit die Besucher sich hinsetzen könnten.
Das taten sie schließlich, und während William sich auf die Suche nach seinen Angehörigen machte, hatte Tinchen Zeit, sich umzusehen. Ihr fiel auf, daß der ganze Raum genau wie sein Inventar makellos sauber war. Der Überwurf auf dem Messingbett mußte frisch gewaschen sein, die aus bunten Flicken genähte Decke auf dem anderen Bett ebenfalls, und die Häkelgardine vor dem einzigen, übrigens scheibenlosen Fenster war blütenweiß. Auf dem festgestampften Lehmboden war nicht ein einziger Krümel zu sehen.
»Da hat bestimmt ein Großreinemachen stattgefunden«, wisperte Florian, »alles zu Ehren des Staatsbesuchs.« Er fühlte sich ein bißchen unbehaglich, und den anderen ging es nicht anders. Zum Glück kam William zurück, ein verlegen lächelndes, sehr robust aussehendes Mädchen hinter sich herziehend. »This is my sister Mary.«
Mary trug ein bedrucktes Kleid aus dünnem Baumwollstoff, und Frau Antonie übersah großzügig, daß darunter eigentlich ein Büstenhalter gehört hätte. Schuhe hatte sie auch nicht an. Die benutze sie nur sonntags oder wenn sie nach Nkribuni gehe, sagte William schnell, als er Frau Antonies fragenden Blick bemerkte. Sie müsse sich erst an das Laufen darin gewöhnen.
Mary sprach kein Englisch und verstand es auch nicht. William mußte übersetzen, was sie sagte, und da sie so gut wie nichts sagte, geriet die Unterhaltung sehr schnell ins Stocken. Wo denn seine Mutter und Jimmy seien, fragte Tinchen.
Die kämen gleich. Jimmy sei bei Nachbarn gewesen, und seine Mama würde ihn gerade holen. Anscheinend ging das nicht ganz komplikationslos vonstatten. Schon von weitem hörten sie Gebrüll, übertönt von einer energischen weiblichen Stimme, und endlich standen Mutter und Sohn in der Tür. Ein Blick auf Mama Kauundas Figur genügte, um Frau Antonie davon zu überzeugen, daß sie ihre lindgrüne Bluse wohl wieder würde mitnehmen müssen. Sie war mindestens zwei Nummern zu klein. Und Mary hätte sie auch nicht gepaßt. Sie hätte sofort die Knöpfe gesprengt.
Mama konnte zwar auch kein Englisch, war aber wesentlich gesprächiger als ihre Tochter, so daß William mit dem Dolmetschen kaum nachkam. Sie freue sich ja so, daß sie die Freunde ihres Sohnes kennenlernen dürfe und nun auch Gelegenheit habe, ihnen für die vielen Geschenke persönlich zu danken. Noch niemals habe sie so herrliche Sachen bekommen.
Das war das Stichwort! William holte die Tüten und packte aus. Nun kam sogar der kleine Jimmy näher. Bis jetzt hatte er am Rockzipfel seiner Mutter gehangen, seine Hände auf dem Rücken versteckt, als Tinchen ihm guten Tag sagen wollte, und den Kopf zur Wand gedreht. Diese Eindringlinge mit der komischen Hautfarbe waren ihm nicht geheuer.
Mißtrauisch schaute er auf den Schokoladenriegel, den ihm Tinchen hinhielt, und erst nachdem William das Papier abgelöst und sich selbst ein Stück in den Mund geschoben hatte, probierte auch Jimmy davon. Sofort spuckte er den Bissen wieder aus. Er kenne keine Schokolade, sagte William entschuldigend.
Mary war schon vor einer ganzen Weile hinausgegangen und kam jetzt mit einem Blechteller zurück. Ob sie den Besuchern etwas anbieten dürfe, übersetzte William. Schon wollte Tinchen ablehnen, denn auf keinen Fall sollte diese Familie ihre kostbaren Lebensmittel opfern, aber als sie sah, was auf dem Teller lag, nickte sie nur stumm und griff nach einem Maiskolben. Zögernd folgten die anderen ihrem Beispiel.
Nun war Tinchen noch nie ein Freund von Mais gewesen. Sie sei kein Huhn, hatte sie immer gesagt und auf dem deutsch-amerikanischen Volksfest jedesmal einen Bogen um die Buden gemacht, an denen frischgerösteter Mais mit zerlassener Butter angeboten worden war. Und Frau Antonies Abneigung gegen diese gelben Körner war mindestens ebenso groß, wenn auch aus anderen Gründen. Beim Anblick von Mais wurde sie immer an die unmittelbare Nachkriegszeit erinnert, als es statt Nudeln und Grieß, wie auf den Lebensmittelkarten ausgewiesen, oft nur Maismehl gab, mit dem sich kaum etwas anfangen ließ.
Trotzdem kauten jetzt beide auf diesen dicken, nur in Salzwasser gegarten Körnern herum, die im Mund immer mehr zu werden schienen.
»Das ist Kuhfutter und kein
Weitere Kostenlose Bücher