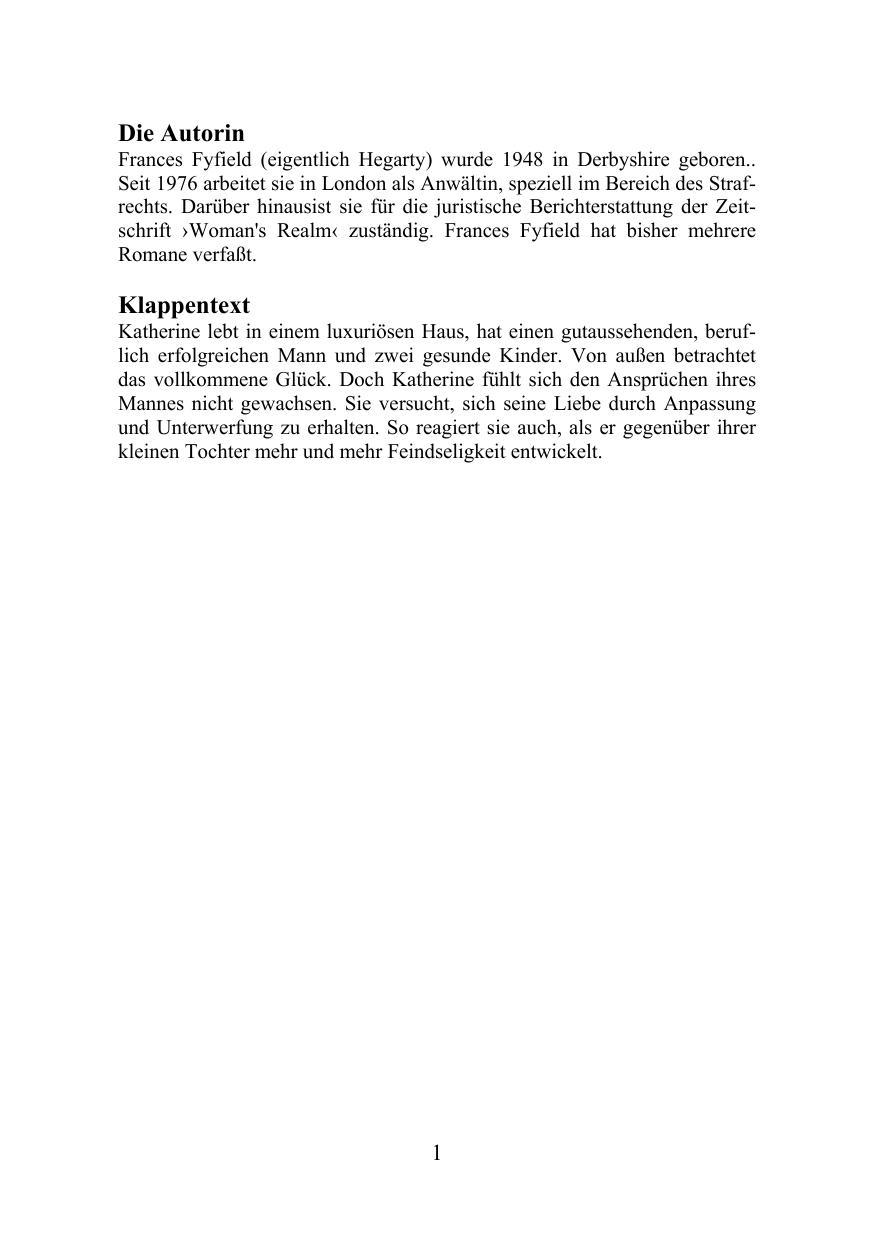![Im Kinderzimmer]()
Im Kinderzimmer
gesprochen zu haben.
Katherine saß auf dem Bett, gärende Schuld machte sie nervös und bedrückte sie. Ich halte es nicht einmal bei meinem eigenen Kind aus, kann es nicht ertragen, wenn sie mich so vertrauensvoll ansieht, bringe es nicht über mich, ihr etwas vorzusingen. Ich bin eine Versa-gerin, eine schlechte Mutter, wollte gar keine Kinder, es ist einfach passiert. Seitdem ist nichts mehr, wie es war, und der Boden rutscht mir unter den Füßen weg. Es soll einen Mutterinstinkt geben, aber ich weiß nicht, wie der funktioniert, weiß nicht, wie ich’s lernen soll, es hat mir niemand beigebracht. Sie hatte ein wenig Angst vor Jeanetta – nicht gerade in diesem Augenblick, aber manchmal. Vor allem, wenn Jeanetta sie zu brauchen schien, dann schrak sie zurück.
Das Kind hatte einen so unbeugsamen Willen. Dafür war Katherine in gewisser Weise dankbar; sie brauchte sich um sie nicht so viel Sorgen machen, denn so ein Kind wäre zäh, würde alles überstehen.
Selbst ein Erdbeben. Sie selbst kam sich zerbrechlicher vor, wollte sich ständig dafür entschuldigen, daß sie so nutzlos war.
»Arme Mama. Du weißt keine Lieder?«
»Nein«, entschuldigte sich Katherine, »ich fürchte nicht.«
»Was hat deine Mama gesungen?«
»Sie hat nicht gesungen, Liebling.« Katherine berührte zaghaft Jeanettas kurze, stoppelige Locken. Ihre Haare waren ihre einzige Zierde gewesen. Sie studierte das kleine Gesicht unter ihrer Hand. Irgendeine Ähnlichkeit mit Claud in den sanften Gesichtszügen? Doch sicher nicht, nein, gewiß nicht.
»Sie hat nie gesungen?« staunte Jeanetta.
»Bitte? Ach so, nein. Nie.« Sich vorzuerzählen, daß sie nicht wissen konnte, wie sie mit den beiden umgehen sollte, weil sie dafür keine inneren Spuren, keine Erfahrung zärtlicher Fürsorge hatte, war eine Ausrede. Es war so einfach, zu sagen: Ich habe keine Erinnerungen an dieses Alter außer dunklen Zimmern, Hunger und dem Bemühen, brav zu sein. Wieso kann dieses kleine Ungeheuer nicht 118
sein wie ich und begreifen, daß die einzige Lösung darin besteht, brav und still zu sein? Und wenn mir als Kind keiner gezeigt hat, was ich tun muß, wie soll ich es jetzt können? Doch Katherine wußte nur zu gut, daß, was Ausreden anbetraf, diese weniger wert waren als das Papier, auf dem die unbrauchbaren Zeitschriftenratschläge gedruckt waren. Die Schuld wurde noch drückender, zugleich die Verärgerung: Einerseits wollte sie bei dem Kind bleiben, andererseits wünschte sie sich fort.
»Die Mama kann nicht so gut singen, weißt du. Und sie kennt auch keine Kinderreime. So eine dumme Mama«, sagte sie sanft, das Herz schwer vor Mitleid und Selbstmitleid. Jeanettas eigenartig bruchstückhafte Sammlung von Reimen war rätselhaft, diese ungewöhnliche Kultiviertheit des Kindes, die ihr selbst abging. Für sie hatte es niemanden gegeben, der vorsang oder Geschichten erzählte, einzige Quelle sporadischer, streng dosierter Unterhaltung: das Fernsehen.
Sie strich über das weiche Kinderhaar, lächelte und schielte zur Tür.
David wartete unten, kümmerte sich um Jeremy. Jeremy, dieser Mu-sterknabe, der seine Mutter nie brauchte. Jeanettas Singsang wirkte beruhigend, lullte sie ein.
»Kann auch nicht richtig singen.«
»Doch, das machst du gut. Sing es der Mama noch einmal vor. Es gefällt mir so. Bitte.« Katherine sah, wie Jeanetta sich wohlig weiter ins Bett herunterwühlte, jeder Verantwortung enthoben, so himmlisch verantwortungslos.
Ach, wieder Kind sein zu dürfen! Wie gerne wäre sie wieder Kind!
119
8
Gottverfluchter Sommer, gottverfluchte Stadt, gottverfluchtes Alles.
Schweißtreibende, schwüle Hitzewelle, mörderische Kopfschmerzen, alles einfach unerträglich und alle unter Gottes verfluchter Sonne Idioten. Die Bluse – war immer schon häßlich! – klebt wie Klopa-pier. Wieder früher nach Hause, weil ich, sagen wir’s doch, wie’s ist, die Arbeit nicht packe und sowieso nicht gebraucht werde. Geht mir nicht anders als dem armen Teufel dort drüben, scheint sich hier in unserer Straße niedergelassen zu haben, seh ihn fast jeden Abend, frag mich, was er hier zu suchen hat. Wie ich ihn hasse, läuft hier ziellos auf und ab! Wie ich. Bitte? Ziellos? Als hätte ich nicht genug zu tun. Und einsam und verzweifelt bin ich auch nicht. Ich habe doch ein Zuhause.
Liegt alles an der Katze, die wieder krank ist. Das bedrückt mich, das ist alles. Das arme Tier. (Sebastian sagt, mir liege mehr an den Tieren als den Menschen…) Streut
Weitere Kostenlose Bücher