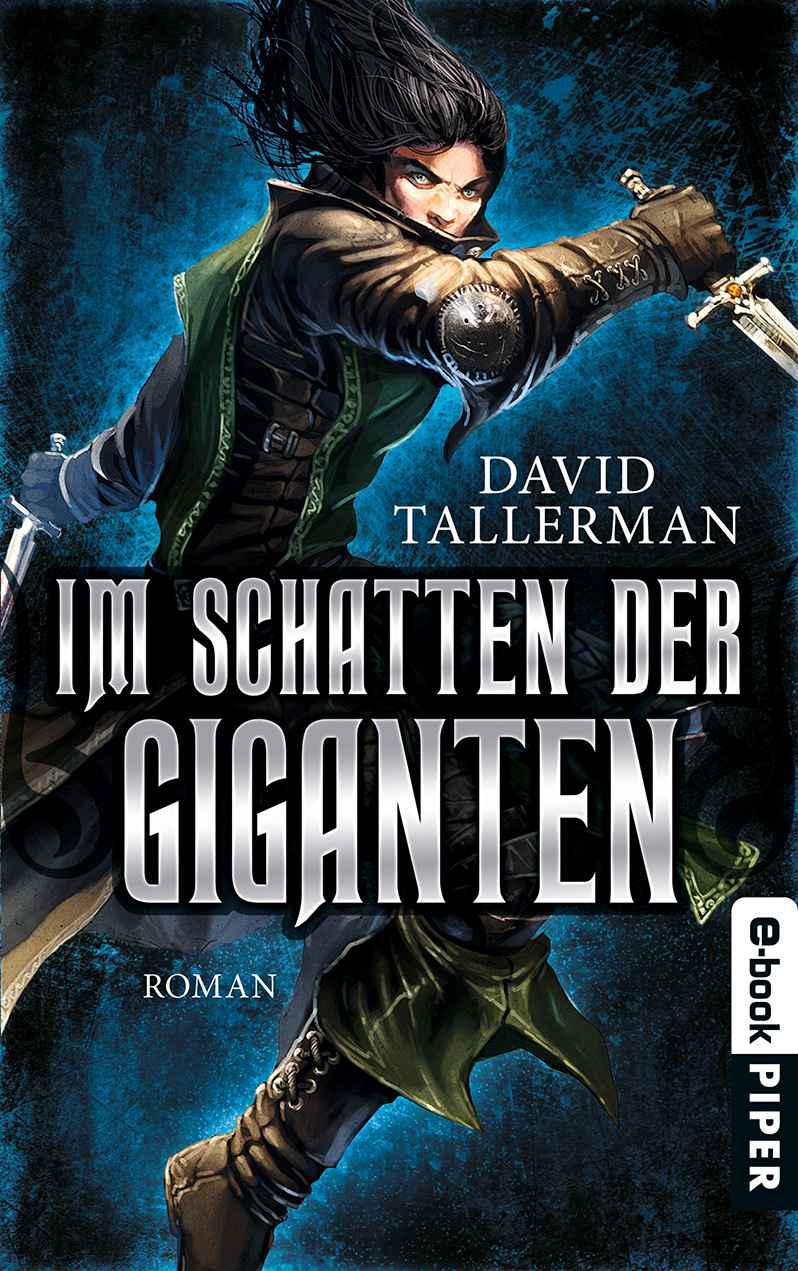![Im Schatten der Giganten: Roman]()
Im Schatten der Giganten: Roman
meine … die ganze Sache. Was hast du dir nur dabei gedacht, einen der fünf berüchtigtsten Verbrecher von Muena Palaiya um Hilfe zu bitten?«
»Die anderen vier ließen mich nicht einmal durch die Tür.«
Ich schwieg verblüfft.
»Nicht dass ich mich dir gegenüber rechtfertigen müsste«, fuhr Estrada fort, »aber Castilio zählte zu den tapfersten und zuverlässigsten Verteidigern des Castoval. Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben, und das gilt auch für dich.«
»Jetzt kennen wir auch den Grund.«
»So siehst du das, Damasco? Du hältst all seine guten Taten für einen Trick? Wäre es nicht möglich, dass der Zwischenfall in der vergangenen Nacht ein Ausrutscher gewesen ist?«
Ich setzte mich ins Gras und fühlte einen größeren Groll, als ich erklären konnte. »Und dass er uns dem Feind ausliefert? Ein weiterer ›Ausrutscher‹? Es entspricht genau dem Bild, das ich über die Jahre hinweg von Mounteban gewonnen habe.«
»›Einmal ein Dieb, immer ein Dieb.‹ In deiner Welt verändern sich die Menschen nicht, oder?«
Dass Mounteban Estrada von unserem Gespräch am Berg erzählt hatte, machte mich noch zorniger. All der Ärger und die Mühen der letzten Tage kochten in mir hoch. Ich konnte es nicht unter Kontrolle halten, und ich wollte es auch gar nicht. Mounteban und Estrada hatten mich in diesen Schlamassel gebracht. Jetzt war Mounteban verschwunden, zu nachtschlafender Zeit, und Estrada verhielt sich so, als wäre es meine Schuld.
Ich sprang wieder auf. »Nein, in meiner Welt versuchen die Menschen zu überleben, und sie versuchen es so lange, wie sie damit durchkommen. Sie bringen andere Leute nicht mit irgendwelchen Manipulationen dazu, ihr Leben zu riskieren, und sie geben nicht vor, jemanden zu schätzen, den sie in Wirklichkeit verachten.«
Ich wusste, dass meine Worte einen wunden Punkt berührten. Erneut hatte ich vergessen, dass Estrada bis vor kurzer Zeit nur Bürgermeisterin eines Provinznestes gewesen war. Sie hatte nicht über Leben und Tod entscheiden müssen, höchstens darüber, auf welche Weise die jährliche Parade stattfinden sollte. Während der letzten Tage hatten die besonderen Umstände Entscheidungen ganz anderer Art von ihr verlangt, was eine enorme Belastung für sie gewesen sein musste.
Es war eine Schwäche, die geradezu danach schrie, ausgenutzt zu werden.
»Wie viele Männer müssen sterben, bevor du zugibst, dass du nicht weißt, was du tust? Was ist mit mir? Oder Salzleck – soll er der Nächste sein? Du hast uns tiefer und tiefer in diesen Mist verwickelt, ohne ein Wort der Erklärung. Jetzt, da nur noch wir drei übrig sind, solltest du es vielleicht mit ein bisschen Ehrlichkeit versuchen. Was machen wir hier eigentlich, Estrada?«
Wenn ich mir eine dramatische Reaktion erhofft hatte, so erlebte ich eine Enttäuschung. Estradas Gesichtsausdruck blieb unergründlich. Sekunden verstrichen. Schließlich sagte sie leise: »Du bist ein Köder.«
»Was?« Ich glaubte, meinen Ohren nicht trauen zu können.
»Du bist ein Köder!« Diesmal schrie sie.
Und dann, zu meiner großen Überraschung, brach Estrada in Tränen aus. Ich konnte den Anblick nicht ertragen, wandte mich ab und lief zur anderen Seite der Lichtung, empört über diese unfaire Strategie. Den Rücken ihr zugewandt, setzte ich mich erneut ins Gras, direkt vor den Weißdornbüschen. Der Zorn war zu einem kalten, harten Knoten in meiner Magengrube geworden. Köder? Ich war für Estrada nicht mehr als ein Wurm, der sich am Haken wand.
Natürlich ergab es einen Sinn. Welches bessere Lockmittel existierte für Moaradrid, der ganz versessen darauf war, Salzleck und mich zu erwischen? Doch ich fühlte mich nicht besser, nur weil ich die Logik darin erkannte. Aber ein Rest von Ruhe inmitten der Wut ermöglichte es mir zu erkennen, wie absurd es war, dass ich mich verraten fühlte – immerhin hatte Estrada nie behauptet, mich nicht zu benutzen. Ich überhörte diese mahnende Stimme. Sie hatte mir etwas versprochen. Na ja, vielleicht nicht direkt versprochen, aber angedeutet. Ja, es hatte die Andeutungen von Versprechen gegeben.
Etwas Schweres berührte mich an der Schulter, so unerwartet, dass ich fast ins Gras gekippt wäre.
»Salzleck?«
Der Riese ragte direkt neben mir auf, wie ein aus der Erde gewachsener bizarrer Monolith.
»Was willst du? Siehst du denn nicht, dass ich …« Ich ließ das Ende des Satzes offen, weil ich nicht »schmolle« sagen wollte, und starrte wieder auf die
Weitere Kostenlose Bücher