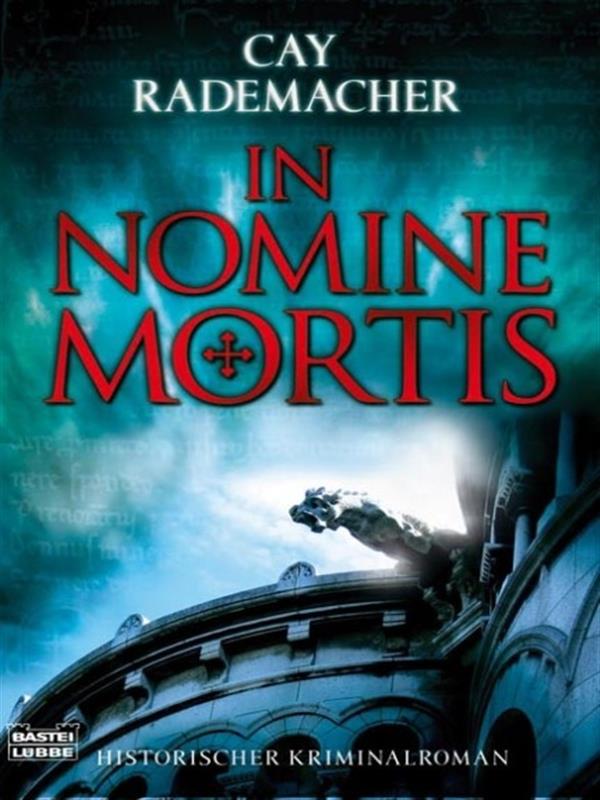![In Nomine Mortis]()
In Nomine Mortis
ging in den Krankensaal, wusch den
erschöpften Mitbrüdern, die oft wochenlang auf den Straßen
gewandert waren, die Füße, verband wund gescheuerte Fersen,
trug eine Paste, die unser heilkundigster Bruder gemischt hatte, auf
sonnenverbrannte Haut auf und linderte mit kalten Umschlägen und Kräutersud
wohl manches Fieber. Die Tage verbrachte ich so und auch die meisten Nächte.
Ich empfand, ich muss es gestehen, eine heimliche Freude an dem, was ich
tat, denn ich erlegte mir diesen Dienst selbst als Buße auf. Indem
ich fast pausenlos arbeitete, vermied ich es, zu viel über die Toten
und über die Lebenden nachzudenken — vor allem über die
Lebenden.
Trotzdem bekam ich Jacquette
nicht vollständig aus meinem Sinn. In jenen Tagen sah ich sie nicht,
denn ich verließ das Kloster nie. Doch fragte ich mich manchmal, wo
sie wohl sein mochte und wie es ihr erging in dieser unruhigen Zeit.
Auch an Klara Helmstede
dachte ich und an ihr aufreizendes Wesen. Vor allem, da Meister Philippe
mir nach einem seiner Gänge durch die Stadt gesagt hatte, dass die
Kogge noch immer im Seinehafen dümpelte.
»Jetzt ist der Reeder
gefangen«, murmelte der Inquisitor grimmig. »Richard Helmstede
wird es nicht wagen, mit seinem Schiff durch ein Land zu segeln, in dem
der Tod an beiden Ufern regiert. Wenn er uns etwas verheimlicht, dann wird
er es uns früher oder später gestehen.«
Vom Vaganten Pierre de
Grande-Rue hingegen fehlte jede Spur. Wie hätten wir ihn auch aufstöbern
können? Wir waren in unserem Dienst ans Kloster gebunden. Die
Sergeanten hatten alle Hände voll zu tun, in der übervölkerten
Stadt für Ordnung zu sorgen. Und zwischen all den Flüchtlingen
mochte es dem Spielmann noch leichter fallen als zuvor, unentdeckt zu
bleiben.
*
So verging ein Tag nach dem
anderen, die Zeit schien zu fliegen, und schließlich wuchs auch in
mir die Ungeduld. Ich wollte wieder hinaus aus dem Kloster, wollte suchen,
forschen, wollte - doch das gestand ich mir nicht ein - zwei Gesichter
sehen, die ich nur in meinem Innern betrachtete.
Der Juni kam und es wurde heiß
und stickig in Paris. Es stank bis hinter unsere Klostermauern, denn mit
den zusätzlichen Menschen gelangte auch mehr Unrat auf die Straßen.
Immerhin waren wir die Ratten los, denn seit dem großen Sterben im
nebligen Frühjahr sah man nur noch wenige Tiere. Dafür plagten
uns nun Flöhe und Wanzen und anderes Getier ärger als in anderen
Jahren. Es war zu Sankt Erasmus, am zweiten Juni-Tag, dass ich die
Gelegenheit fand, mich aus dem Kloster zu stehlen. Es war nach der Terz:
Ich ging zum Portarius und sagte ihm, dass mich unser heilkundiger Bruder
hinausschickte, auf dass ich irgendwo in Paris getrockneten Salbei und
noch einige andere lindernde Kräuter kaufen möge. Das war nicht
einmal gelogen, denn tatsächlich hatte ich mich entboten, an Medizin
zu kaufen, was überhaupt noch zu kaufen war. Tatsächlich
streifte ich dann wohl zwei Stunden über die Plätze und durch
die Gassen, um bei Apothekern nützliche Dinge zu erstehen. Die Preise
waren hoch, ja wucherisch - oft zahlte ich vier, fünf Sous und noch
mehr für ein kleines Säckchen mit Kräutern vom letzten
Jahr. Doch sagte ich mir, dass es, so, wie die Dinge standen, in den nächsten
Wochen kaum besser werden mochte. Als ich schließlich alle
Besorgungen erledigt hatte, ging ich zurück über den Grand Pont.
Dort, auf der Brücke der Geldwechsler, sah ich mich im Gedränge
rasch um — und trat mit einem eiligen Schritt ins »Haus zum
Falken«.
»Endlich seid Ihr
gekommen, Bruder!«, rief der junge, höfliche Gehilfe in der
Wechslerstube. »Messer Datini erwartet schon seit Tagen mit Ungeduld
Euren Besuch.«
Ich verzichtete auf eine
Antwort und nickte nur würdevoll, doch am liebsten hätte ich
jubiliert: Denn was konnte dies anderes sein als eine gute Nachricht?
Und es war eine gute
Nachricht. Pietro Datini hieß mich, auf einem Stuhl in seinem
Arbeitszimmer Platz zu nehmen. Ich bewunderte heimlich sein prächtiges
blaues Wams, das seiner kurzgewachsenen, hageren Statur etwas Imposantes
verlieh.
»Ich habe eine
Geschichte gehört, die Euch schwerlich gleichgültig lassen wird«,
begann er das Gespräch. Vorsichtig und höflich wie immer; nur
sein Florentiner Akzent, der seine Worte noch mehr tränkte als sonst,
verriet seine innere
Weitere Kostenlose Bücher