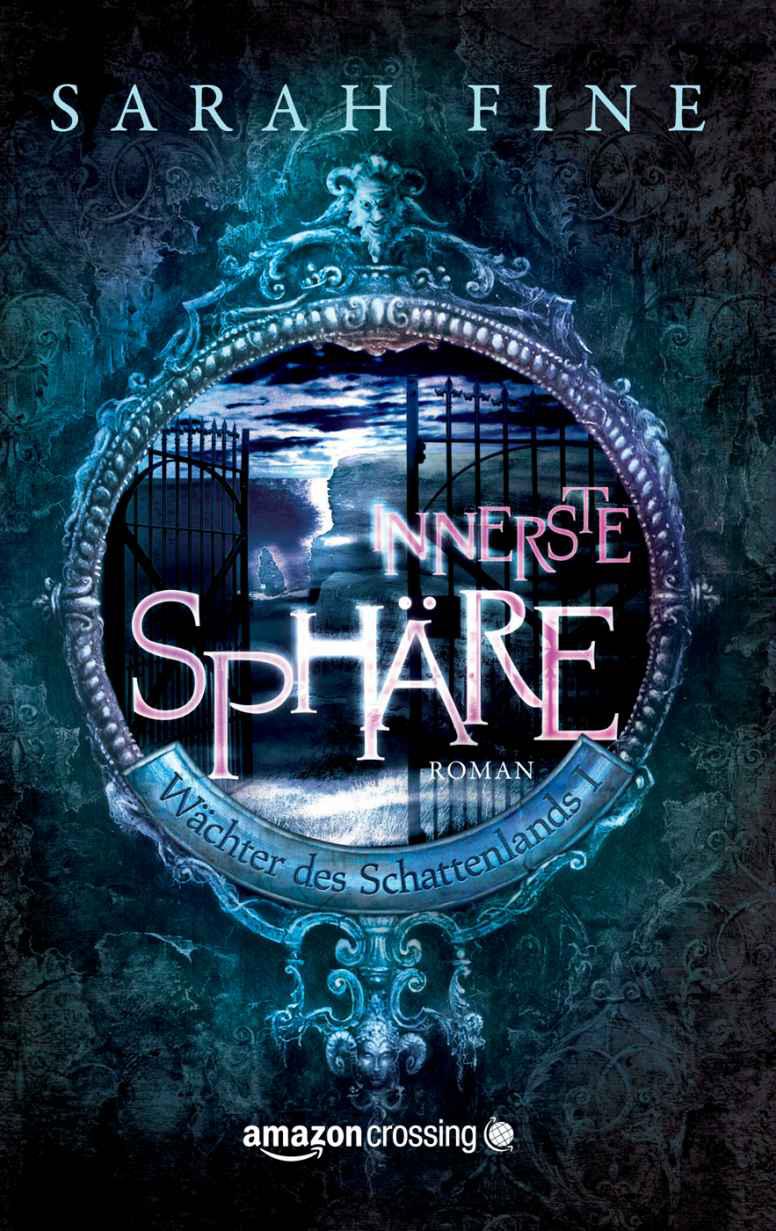![Innerste Sphaere]()
Innerste Sphaere
die auf dem Teppich wuchsen. Es war totenstill und wären nicht die Streifen grünlichen Lichts unter den Türen der Wohnungen gewesen, hätte ich gesagt, das Gebäude sei menschenleer. Es dauerte eine Ewigkeit, aber es gelang mir, ihn den Korridor entlang zur ersten offenen Tür zu bringen, auf die wir stießen.
Erleichtert stellte ich fest, dass der fadenscheinige Teppichboden in der Wohnung schimmelfrei war und die Wände in einfachem Graubraun – ohne Moderstreifen. Die Furniermöbel und die schartigenOberflächen vermittelten eine Atmosphäre ähnlich wie in den Sozialwohnungen, in denen ich aufgewachsen war. Aber einen Unterschied gab es schon. »He, da ist kein Schloss an der Tür. Soll ich ein paar Möbel davor rücken?«
Malachi schüttelte den Kopf. »Niemand kann rein, solange wir hier sind«, sagte er heiser.
»Warum? Weil du ein Wächter bist?«
Wieder schüttelte er den Kopf. So eine harmlose Bewegung, aber sie schien ihn viel Kraft zu kosten. »Sobald eine Wohnung belegt ist, kann kein anderer rein.«
Ein Stein fiel mir vom Herzen. Wir waren in Sicherheit. Aber wichtiger noch – Nadia ebenfalls. Sie war in eine Wohnung geflohen und wer immer hinter ihr her war, konnte ihr nicht folgen. Ich hoffte, dass sie dort geblieben war.
Ich schleppte Malachi durch eine Tür in ein Schlafzimmer, in dem eine schmale Liege stand. »Hinlegen, Junge«, sagte ich, als ich ihn vorsichtig auf die Liege bettete. Meine Hüfte tat höllisch weh und mein restlicher Körper fühlte sich nicht viel besser an. Malachi war unglaublich schwer. Aber ausruhen durfte ich mich erst, wenn ich Hilfe geholt hatte.
Seine Hand plumpste auf eine der Schnallen an seiner Brust. »Ich kriege keine Luft.«
»Geht klar«, sagte ich. »Sehen wir zu, dass alles passt, dann zieh ich los.«
»Nein«, stöhnte er, aber ich achtete nicht auf ihn und machte mich an die Arbeit. Ich schob seine Hände weg und löste nacheinander die Schnallen an seinem Brustpanzer, unbeholfen versuchte ich, den Panzer abzunehmen, ohne seinen Hals zu berühren. Als mir das misslang, stieß er einen so herzzerreißenden Laut aus, dass ich ebenfalls aufschrie.
Als ich den Panzer entfernt hatte, nahm ich mir seinen Gürtel vor. »Nicht«, bat er und seine Arme zuckten hilflos. Wieder ignorierte ich ihn und konzentrierte mich auf meine Aufgabe. Hätte ich nichts zu tun gehabt, wäre ich wahrscheinlich von Panik, Verzweiflung und Schuldgefühlen überwältigt auf dem schmutzigen Teppichzusammengebrochen. Er war meinetwegen verwundet worden. Womöglich würde er meinetwegen sterben.
»Du kannst deine Waffen nicht gebrauchen. Sie nützen dir im Moment nichts.« Nun zog ich ihm den Gürtel vom Leib und platzierte ihn neben der Liege. Ich legte ihm die Hand auf die Brust und spürte, wie flach sein Atem ging. Sein Hemd war vorne blutgetränkt. Ich hatte nicht geahnt, dass die Blutung so stark gewesen war. »Du musst mir sagen, wie ich zur Station komme.«
»Ich dachte, ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig zu dir«, sagte er. »Es tut mir so leid, dass du verletzt wurdest. Ich hätte schneller sein müssen.«
Ich fasste es nicht, er wollte sich doch tatsächlich bei mir entschuldigen, wo er doch allen Grund gehabt hätte, mich zu hassen. So sanft und traurig wie seine Stimme klang, glaubte er wohl, dass dies die letzten Worte sein würden, die er mir sagte. Das ging mir zu Herzen. »Du verschwendest Atemluft und meine Zeit«, erwiderte ich barsch. »Jetzt beschreib mir den Weg oder ich bringe dich eigenhändig um.«
Er lachte keuchend. »Du bist so ein erstaunliches Wesen.«
Verdammt.
»Komm schon. Raus mit der Sprache. Wegbeschreibung. Jetzt.«
»Es war mein Fehler, dass ich dich in diese Zelle gesperrt habe. Aber wenn nicht, hätte ich –«
Um ihn zur Vernunft zu bringen, schlug ich ihm ins Gesicht. Nicht gerade therapeutisch überzeugend, aber er war wirklich weggetreten, und ich hatte keine Ahnung, wie ich die Station finden und Hilfe holen sollte. Er reagierte kaum und ich bekam panische Angst. Also beugte ich mich über ihn und umfasste sein Gesicht mit beiden Händen, weil ich vorhatte, ihn zu schütteln, bis er mit der Sprache rausrückte.
Er schaute mich aus glänzenden braunen Augen an. »Du bist so schön«, nuschelte er – zweifellos wurden gerade seine Lippen taub, dicht gefolgt von seinem Hirn.
Typisch. Zum ersten Mal sagt mir ein Typ, ich wäre schön, und dann bin ich in der Hölle und er im Delirium.
»Bitte beschreib mir den Weg.
Weitere Kostenlose Bücher