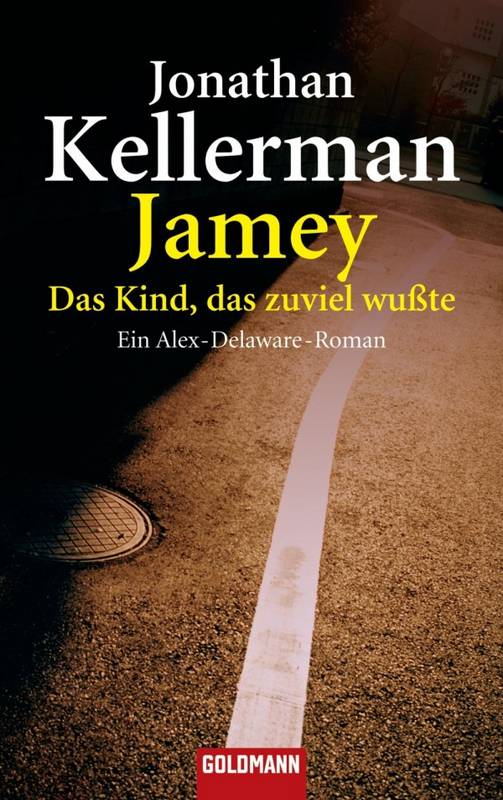![Jamey. Das Kind, das zuviel wußte]()
Jamey. Das Kind, das zuviel wußte
nicht mehr in den Kindergarten.«
Er leckte sich Ketchup von der Unterlippe. »Das war’s mit der Schule.« Er sah auf die Uhr: »Oh, ich muss telefonieren!«, und weg war er.
Danach besuchte er mich jeden Freitag und trug mir seine Ideen vor. Wir redeten in meinem Büro, in der Bibliothek, im Schnellrestaurant oder beim Spazierengehen auf dem Campus. Er hatte keinen Vater, und obwohl sich sein Onkel um ihn kümmerte, hatte er wenig Vorstellungen davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Er stellte mir tausend Fragen über mich, in einer Weise, wie ein Immigrant versucht, tausend Einzelheiten über seine neue Heimat zu erfahren. Ich wurde eine Art Vorbild für ihn. Unser Fragespiel war absolut einseitig, sobald ich versuchte, ihn etwas über seine Person oder sein Leben zu fragen, wechselte er das Thema oder wurde hoffnungslos abstrakt.
Unser Verhältnis war unbestimmt, weder waren wir Freunde, noch konnte man es Therapie nennen, denn er hatte mich ja nie ausdrücklich um Hilfe gebeten. Kopforientiert wie er waren die meisten Kinder, die an unserem Projekt teilnahmen. Er bat nicht um Hilfe, er wollte immer nur reden, reden, reden. Über Psychologie, Philosophie, Politik oder Literatur.
Aber ich blieb bei meinem Verdacht, dass er mich an jenem ersten Freitag aufgesucht hatte, damit ich ihn von einer Last befreite, die ihm schwer zu schaffen machte. Ich beobachtete, dass er oft niedergeschlagen war und manchmal Angst zu haben schien, dass er sich tagelang zurückzog und depressiv wirkte. Ich hatte bemerkt, dass er manchmal einen finsteren Blick oder Tränen in den Augen hatte, mitten in einem ganz harmlosen Gespräch, manchmal wurde ihm die Kehle eng, oder seine Hände zitterten.
Dieser Junge wurde von irgendeinem Problem gepeinigt, darüber konnte es keinen Zweifel geben. Sein Kummer war tief verborgen wie ein verpuppter Engerling in seinem Kokon, und es würde sehr schwierig sein, ihn ans Licht zu holen. Ich beschloss, den richtigen Augenblick abzuwarten. Es ist gut, wenn ein Therapeut weiß, was er sagen soll, wichtiger aber ist, es im richtigen Moment zu sagen. Wenn er zu früh zu sprechen beginnt, kann alles verloren sein.
Bei unserem sechzehnten Treffen kam er mit einem Stapel Soziologiebücher zu mir und fing an, über seine Familie zu reden, angeregt durch einen Band über Familienstrukturen. Als läse er aus dem Buch vor, erzählte er mir mit einer Stimme, die jeglicher Gefühle entbehrte, dass die Cadmus »im Geld schwämmen«, sein Großvater väterlicherseits habe ein Imperium von Bau- und Maklerfirmen in Kalifornien ins Leben gerufen. Zwar sei der alte Herr längst tot, aber von ihm würde immer noch geredet wie von einem Gott. Seine Großeltern mütterlicherseits seien tot, seine Eltern ebenfalls. Seine Mutter war im Kindbett gestorben, er hatte Fotos von ihr gesehen, aber sonst wusste er kaum etwas von ihr. Drei Jahre nach dem Tod seiner Frau hatte Jameys Vater sich durch Erhängen das Leben genommen. Der jüngere Bruder seines Vaters habe es übernommen, sich um das elternlose Kleinkind zu kümmern. Dieser hatte zahlreiche Kindermädchen beschäftigt, von denen aber keines lange genug geblieben war, um Jamey irgendetwas zu bedeuten. Ein paar Jahre später habe Onkel Dwight auch geheiratet und hätte selbst zwei Töchter. So wären sie alle inzwischen eine glückliche Familie. Den letzten Satz sprach er voller Bitterkeit aus und sah mich eindringlich an, ihm ja keine Fragen zu stellen.
Ein Thema, über das ich später mit Jamey reden wollte, war der Selbstmord seines Vaters. Er selbst schien keinerlei Absichten in dieser Richtung zu haben, trotzdem hielt ich ihn für suizidgefährdet. Seine häufige Niedergeschlagenheit, sein Perfektionismus, seine manchmal ganz unrealistischen Erwartungen und sein mitunter schwaches Selbstbewusstsein ließen mich aufhorchen. Hinzu kam der Selbstmord des Vaters, wer weiß, ob er nicht eines Tages dasselbe tun würde.
Als wir uns zum zwanzigsten Mal trafen, kamen die Dinge in Gang.
Jamey sagte gerne Gedichte auf, Shelley, Keats, Wordsworth, besonders aber liebte er einen Autor mit Namen Thomas Chatterton, von dem ich noch nie gehört hatte. Als ich danach fragte, sagte Jamey von oben herab, dass das Werk eines Dichters für sich selbst spräche. Ich ging in die Bibliothek und machte mich kundig. Einen Nachmittag lang wühlte ich mich durch verstaubte Bände mit Kommentaren zu Chattertons Leben und Werk. Ich stieß auf interessante Details. Alle Forscher
Weitere Kostenlose Bücher