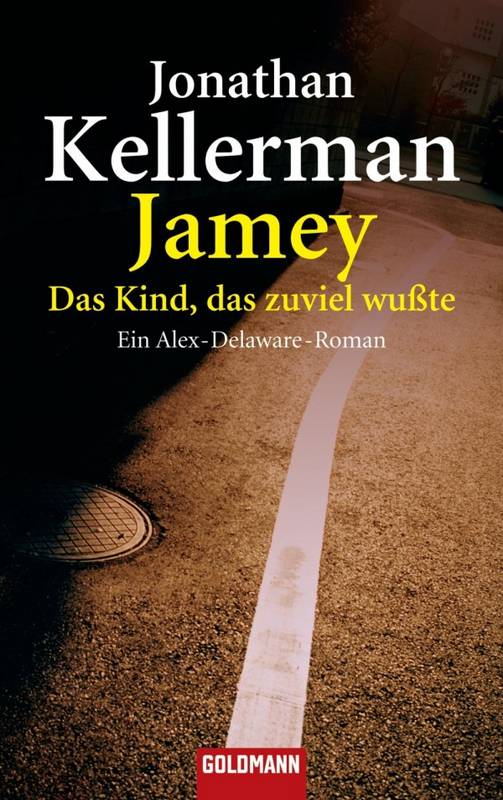![Jamey. Das Kind, das zuviel wußte]()
Jamey. Das Kind, das zuviel wußte
hingen Dienstanweisungen und einige technische Geräte.
Ich stand da und wartete in unwirtlicher Stille, gespannt, was ich auf der anderen Seite der Tür erleben würde. Zwar war ich kein Gefangener, doch fühlte ich mich den Leuten, die das Recht hatten, Türen zu öffnen, auf seltsame Weise ausgeliefert. Mir war unbehaglich zumute, ich kam mir vor wie ein Kind, das zum ersten Mal in einer Achterbahn sitzt und nicht weiß, ob ihm die Fahrt gefällt oder nicht, und das hofft, dass sie bald vorüber ist. Als sich schließlich die dunkle Tür an der hinteren Wand öffnete, stand ich einem jungen Mexikaner gegenüber, der Zivil trug, ein hellblaues T-Shirt, eine grünblaue Schottenkrawatte, einen maronenfarbenen Pullover mit V-Ausschnitt, graue Cordhosen und Schnürschuhe mit Kreppsohle. Die Kennkarte, die er am Kragen trug, wies ihn als Sozialarbeiter aus. Er war groß und hager, seine Arme und Beine waren auffällig lang. Er trug einen Bürstenschnitt, der mit viel Gel geglättet war. Seine riesigen Ohren ließen ihn aussehen wie Mister Spock, ein Eindruck, der sich noch verstärkte, als er zu reden begann; denn seine Stimme klang so gleichgültig wie eine Morsebotschaft.
»Dr. Delaware, mein Name ist Patrick Montez. Ich soll Sie hier herumführen, damit Sie sich orientieren können. Bitte folgen Sie mir.«
Jenseits der Tür erwartete mich ein weiter, kahler, gelb gestrichener Flur. Als wir ihn betraten, blickte einer der Beamten in der Loge aufmerksam nach rechts und links. Montez führte mich zu einem Aufzug, mit dem wir mehrere Stockwerke hinauffuhren. Oben traten wir hinaus auf einen Flur, ebenfalls gelb, aber ein wenig leuchtender und mit Blau verziert. Am Ende des Flures sah ich durch eine offene Tür mehrere zerwühlte Krankenbetten.
»Gehen wir in mein Büro«, sagte Montez und zeigte auf eine Tür.
Entlang der Wand vor seinem Zimmer stand eine Holzbank, auf der an den beiden äußersten Ecken zwei Männer saßen, die gelbe Pyjamas trugen, beide in sich zusammengesunken. Der erste war ein dunkelhäutiger Mexikaner von gedrungenem Wuchs, etwa sechzig Jahre alt, mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen und einem traurigen Gesicht. Der andere war viel jünger, etwa zwanzig Jahre alt. Er hatte hellblonde Locken, war braun gebrannt und muskulös. Er hätte die idealen Züge eines Dressmans besessen, hätte nicht sein Gesicht dauernd nervös gezuckt. Während wir vorübergingen, schaute der Mexikaner weg, der junge Mann aber wandte sich uns zu. Wildheit lag in seinem Blick, und er fletschte die Zähne. Er versuchte aufzustehen. Ich sah zu Montez hinüber, aber er blieb ruhig. Der blonde Junge stieß eine Art Grunzen aus und hob sein Hinterteil von der Bank hoch, jedoch nur wenige Zentimeter, und zuckte dann heftig zurück, als habe ihn eine unsichtbare Hand festgehalten. Dann erst sah ich die Fesseln, die er um die Handgelenke trug - metallene Handschellen, welche an der Bank festgekettet waren. Jetzt erschien ein Beamter mit Gummiknüppel. Der Junge stieß raue Kehllaute aus. Er ließ sich mehrmals mit dem Rücken gegen die Lehne fallen, dann sank er wieder in sich zusammen, keuchte und murmelte obszöne Dinge vor sich hin.
»Kommen Sie doch bitte herein, Doktor«, sagte Montez, als sei nichts Besonderes geschehen. Er nahm seinen Schlüsselbund zur Hand, öffnete und ließ mich eintreten.
Das Büro war eingerichtet wie alle Verwaltungsräume in öffentlichen Gebäuden: Tische aus grau gestrichenem Metall, einfache Bürostühle, ein Pinnbrett aus Kork mit Terminen und Rundschreiben. Der Raum war fensterlos, an der Decke war ein Ventilator befestigt. Ein üppig wachsender Efeu in einem Topf stand auf einem Tisch, daneben ein Monitor, der brummte und zischte, bis der Sozialarbeiter ihn abstellte.
»Wir haben hier das größte Gefängnis der Welt«, sagte Montez, »5100 Insassen können wir unterbringen, momentan sind es nur 3700. Aber an Wochenenden, an denen in der Stadt so richtig was los war, hatten wir auch schon 16000.«
Er griff in eine Schublade und zog einen Totschläger heraus. »Möchten Sie den?«, fragte er.
»Nein, danke«, antwortete ich erstaunt.
Nun steckte sich Montez ein Bonbon in den Mund.
»Sind Sie Psychotherapeut?«
»Ja.«
»Wir haben zwei verschiedene Abteilungen hier. Eine Haftabteilung und eine für psychisch Kranke. Wir sollen eigentlich zusammenarbeiten, aber die Psychofälle sind nur eine Minderheit. Die meisten hier sind Untersuchungsgefangene oder schon verurteilte normale
Weitere Kostenlose Bücher