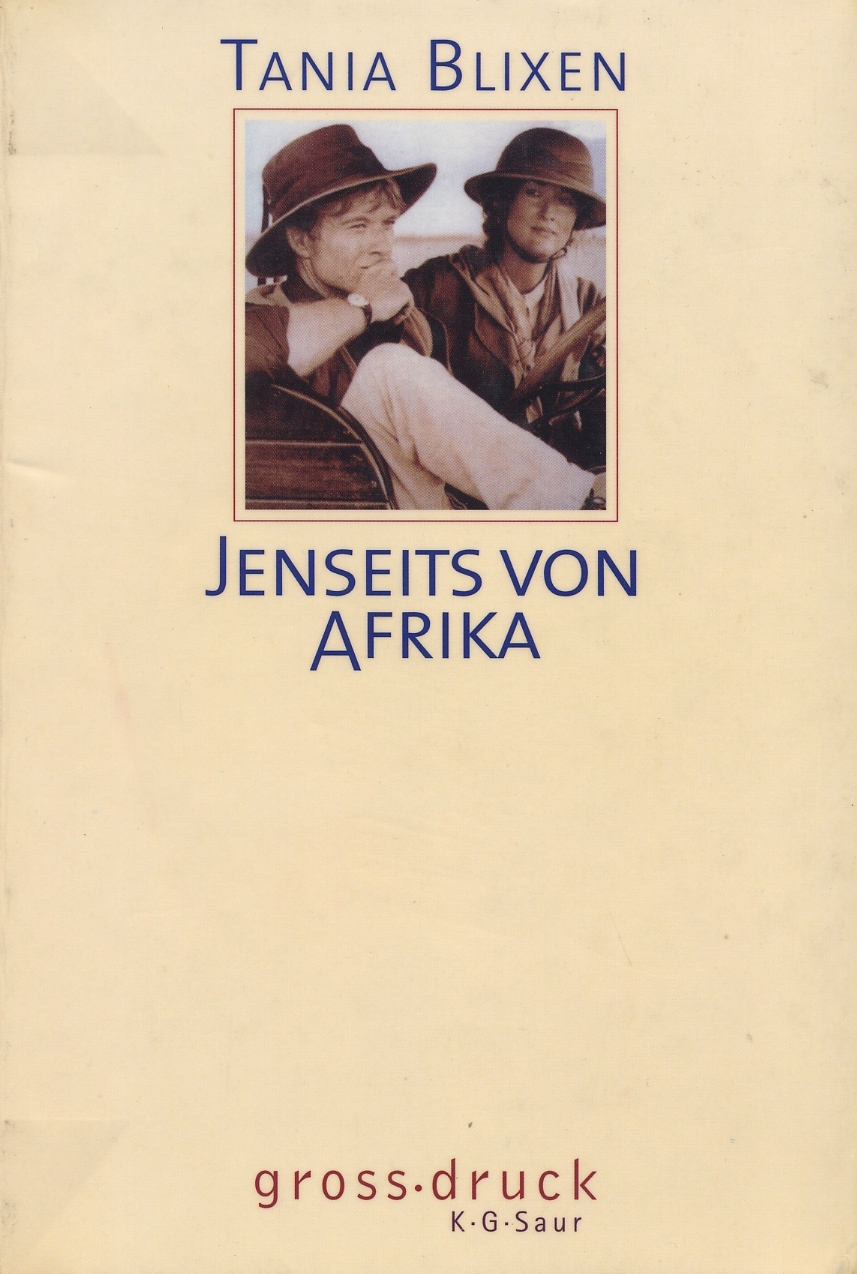![Jenseits von Afrika]()
Jenseits von Afrika
weniger und weniger von Lulu und den Ihren gesehen. In dem Jahre, bevor ich fortging, sind sie, glaube ich, nicht mehr gekommen. Es hatte sich alles verändert, im Süden der Farm war das Land an Siedler vergeben worden, der Wald war hier abgeholzt, und Häuser waren gebaut worden. Traktoren keuchten auf und nieder, wo vordem die Lichtungen ge wesen waren. Viele von den neuen Siedlern waren eifrige Jäger, und die Schüsse hallten durch die Landschaft. Ich glaube, das Wild verzog sich nach Westen und wechselte hinüber in die Wälder des Massaireservats.
Ich weiß nicht, wie lange eine Antilope lebt, vielleicht ist Lulu schon lange tot.
Oft, sehr oft, habe ich in den stillen Stunden des Morgengrauens geträumt, ich hörte Lulus helles Glöckchen, und mein Herz hat sich im Traum mit Freude erfüllt, ich bin erwacht und habe gemeint, irgend etwas Seltsames und Köstliches müsse gleich im nächsten Augenblick geschehen.
Wenn ich dann lag und an Lulu dachte, habe ich mich gefragt, ob sie in ihrem Leben im Walde wohl je von dem Glöckchen geträumt hat? Ob wohl durch ihren Geist, wie Schatten übers Wasser, Bilder von Menschen oder Hunden gezogen sind?
Wenn ich ein Lied weiß von Afrika, dachte ich, von der Giraffe und dem afrikanischen Neumond, der auf dem Rücken schwebt, von dem Pflug in den Feldern und den schwitzenden Gesichtern der Kaffeepflücker – weiß wohl Afrika ein Lied von mir? Zittert wohl die Luft über der Steppe in einer Farbe, die ich getragen habe, denken die Kinder ein Spiel aus, in dem mein Name vorkommt, oder wirft der volle Mond einen Schatten über den Weg, der so ist wie meiner, oder schauen die Ngongadler nach mir aus?
Von Lulu habe ich nichts wieder gehört, aber von Kamante und meinen anderen Hausboys habe ich wieder gehört. Erst vor einem Monat hatte ich den letzten Brief von ihm. Aber diese Botschaften aus Afrika kommen in einer seltsam unwirklichen Gestalt zu mir, sind mehr wie Schatten oder Trugbilder der Wirklichkeit als wie ihre Boten. Denn Kamante kann nicht schreiben und versteht kein Englisch. Wenn er oder einer meiner Leute den Gedanken faßt, mir Nachricht von sich zu geben, dann gehen sie zu einem der beruflichen indischen oder schwarzen Briefschreiber, die mit ihrem Schreibpult, Papier, Feder und Tinte vor dem Postamt sitzen, und setzen ihm auseinander, was in dem Brief stehen soll. Die beruflichen Schreiber können auch nicht allzuviel Englisch und verstehen eigentlich kaum zu schreiben, aber sie glauben, es zu verstehen. Um ihre Kunst zu zeigen, bereichern sie den Brief mit allerlei Zieraten, die es schwer machen, ihn zu entziffern. Sie haben auch die Gepflogenheit, die Briefe mit drei oder vier verschiedenen Arten Tinte zu schreiben; das mag irgendeinen Sinn haben, es wirkt aber so, als wäre ihnen die Tinte ausgegangen und als quetschten sie aus den verschiedenen Flaschen noch den letzten Tropfen aus. Das Ergebnis all dieser Bemühungen ist eine Botschaft von der Art, wie man sie vom Orakel von Delphi erhielt. Es steckt etwas in den Briefen, die ich bekomme, man fühlt, daß sie etwas Lebendiges enthalten, was dem Absender schwer auf dem Herzen gelegen hat, was ihn dazu gebracht hat, den langen Weg vom Kikujureservat bis zum Postamt zu gehen. Aber es ist mit Finsternis umkleidet. Das billige, schmierige kleine Stück Papier hat bis zu mir viele tausend Meilen wandern müssen, nun spricht und spricht, ja, schreit es mich an und sagt doch nichts.
Kamante geht auch als Briefschreiber eigene Wege. Er steckt drei oder vier Briefe in den gleichen Umschlag und bezeichnet sie als »erster Brief«, »zweiter Brief« und so fort. In allen steht dasselbe, immer und immer noch mal wiederholt. Vielleicht meint er durch die Wiederholung einen tieferen Eindruck zu machen – er hatte auch beim Sprechen diese Art, wenn er wollte, daß ich etwas besonders auffassen oder mir merken sollte –, vielleicht fällt es ihm schwer, aufzuhören, wenn er fühlt, daß er mit einem Freunde, der so sehr weit weg ist, Verbindung bekommen hat.
Kamante schreibt, daß er lange Zeit arbeitslos gewesen ist. Ich wundere mich nicht, das zu hören, denn er war wirklich Kaviar fürs Volk. Und dann bedurfte es ihm gegenüber eines »Sesam, öffne dich«. Das Zauberwort ist nun verloren, und der Stein hat sich für ewig über den mystischen Schätzen geschlossen, die er barg. Wo einst der große Küchenchef tief versonnen voller Weisheit wandelte, sieht heute niemand mehr etwas anderes als einen kleinen
Weitere Kostenlose Bücher