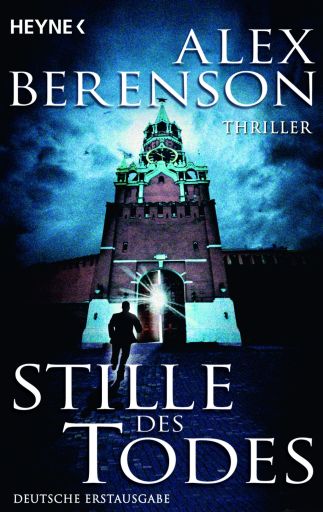![John Wells Bd. 3 - Stille des Todes]()
John Wells Bd. 3 - Stille des Todes
und Regale, die sich unter Werken in deutscher und türkischer Sprache bogen. Aber bis auf ein paar gerahmte Koranverse und ein einziges Foto der Kaaba, des schwarzen Steins von Mekka, keine Bilder. Das deutete darauf hin, dass Bernhard ein frommer Mann war. Gläubige Muslime waren davon überzeugt, dass der Koran die Zurschaustellung von Bildern untersagte, weil diese unnötig mit der Größe Allahs konkurrierten. Dieses Verbot galt nicht für das Fernsehen: An der Wohnzimmerwand hing ein enormer Sony-Flachbildfernseher.
Nur einmal begehrte Bernhards Frau, deren Namen Wells immer noch nicht kannte, auf - als Wells eine Tür in der rückwärtigen Wohnzimmerwand öffnen wollte.
»Nein!« Sie drohte ihm mit dem Finger. »Verboten.«
» Verboten? Du machst mir Spaß.« Wells drückte die Klinke herunter. Abgesperrt, aber nur mit einem einfachen Schnappermechanismus. Er holte eine Kreditkarte aus seiner Brieftasche und öffnete.
Dahinter lag ein kleines, ordentlich aufgeräumtes Büro
mit zwei Aktenschränken und einem schönen braunen Schreibtisch. Eine Weltkarte zeigte die Schifffahrtsrouten von Hamburg nach Istanbul, Lagos, Accra, Kapstadt und Dubai, allerdings nicht in die Vereinigten Staaten. Zwei dicke Lederbände mit geprägten Schiffen auf dem Einband und den Titeln Seerecht und Seegesetz . Ein Kaffeebecher mit dem Logo der Nittany Lions, der Fußballmannschaft der Penn State University. Wells nahm sie, betrachtete sie neugierig und stellte sie wieder ab. Ein teurer Füller mit passendem Bleistift. Eine Dockingstation für ein ThinkPad, obwohl von dem Laptop selbst weit und breit nichts zu sehen war. Eine Handvoll Dokumente in einem Ablagekorb aus Plastik. Wells ging sie durch, aber das einzig Interessante war eine Rechnung der New Yorker Kanzlei Snyder, Gonzalez & Lein über zweiunddreißigtausend Dollar für die »Geltendmachung von Versicherungsansprüchen«.
Bernhards Frau beobachtete ihn mit finsterer Miene von der Tür aus. Offenbar war es ihr streng verboten, den Raum zu betreten.
Wells probierte es mit den Aktenschränken, die sich zu seiner Überraschung öffneten. Die Ordner in den Hängeregistraturen waren nach Jahren geordnet. Ein Schrank schien ausschließlich deutsche Steuerunterlagen zu enthalten, der andere Versandrechnungen und Zollformulare. Keine Baupläne für Atomwaffen, obwohl die Steuerformulare auch ziemlich furchteinflößend aussahen. Wells hob die Aktenschränke an, zog sie ein paar Zentimeter vor und spähte in den Spalt dahinter. Dann fuhr er mit der Hand über die Unterseite der Schreibtischplatte und bückte sich, um nach Geheimfächern zu suchen. Er nahm die Karte von der Wand - kein versteckter Safe.
Nichts. Nirgends. Boden und Wände wirkten massiv, obwohl er nicht die Zeit für eine eingehende Untersuchung hatte und sein Glück nicht herausfordern wollte. Wirklich wichtig war nur der Computer, und den ließ Bernhard offenbar nicht aus den Augen.
»Gehen wir«, sagte er. Er ließ die Tür zum Büro offen, doch Bernhards Frau schloss sie.
Im Wohnzimmer fläzte sich Wells auf das Sofa und legte die Füße auf den Couchtisch aus Glas. Aus seiner neuen Aktentasche holte er zwei sorgfältig in Plastik eingewickelte Blöcke eines hellgrauen Metalls, die etwa die Größe eines Ziegelsteins hatten. Das Metall stammte direkt aus einem Lager des amerikanischen Energieministeriums in Oak Ridge, Tennessee, was ihm natürlich nicht anzusehen war. Wells hatte Shafer erklärt, er brauche genug Beryllium, um Bernhard hinzuhalten und ihn zu überzeugen, dass er es ernst meinte. Shafer hatte Duto überreden können, die »Leihgabe« abzuzeichnen, nachdem die Waffenentwickler in Los Alamos bestätigt hatten, dass zehn Kilogramm Beryllium zu wenig waren, um für die Bombenbauer einen merklichen Unterschied zu machen, selbst wenn es Bernhard gelang, ihnen das Material zukommen zu lassen.
Wells tippte auf die Blöcke. »Nicht anfassen«, sagte er zu Bernhards Frau. » Verboten. Das meine ich ernst. Verstanden?«
Die Berührung von Beryllium war zwar ungefährlich, aber sich lösende Partikel des spröden Leichtmetalls verursachten üble Entzündungen in der Lunge.
Sie nickte.
»Gut«, sagte er und hielt ein imaginäres Telefon ans Ohr. »Sag Bernhard, ich rufe ihn heute Nacht an.«
Wells stieg in den Mercedes, den er mittlerweile - zumindest in seiner Rolle als Roland Albert - als seinen eigenen betrachtete und fuhr an einem Servicetransporter der Deutschen Telekom vorbei, der fünfzig
Weitere Kostenlose Bücher