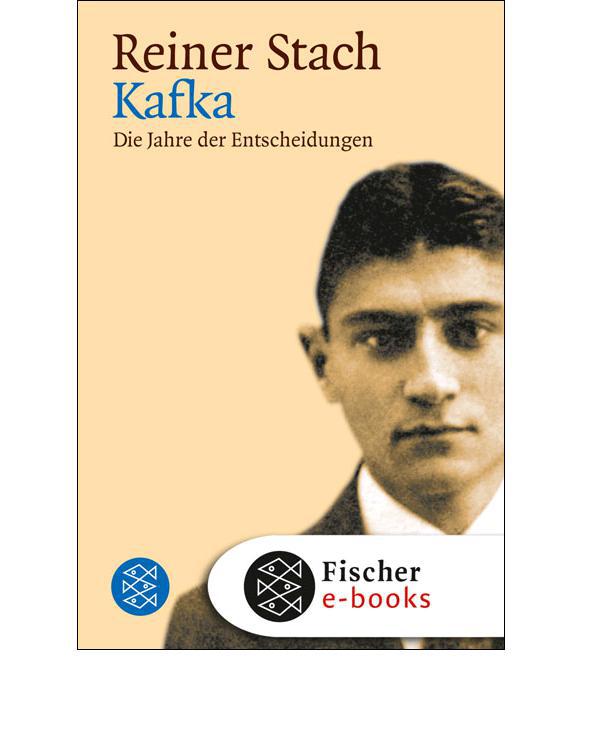![Kafka: Die Jahre der Entscheidungen (German Edition)]()
Kafka: Die Jahre der Entscheidungen (German Edition)
alt in München 1921 starb. Fern von mir und ihm, von dem ich mich schon im Krieg trennen mußte und dann nicht wieder sah – bis auf wenige Stunden – weil er einer tödlichen Krankheit, in seiner Heimat, fern von mir, erlag. Niemals sprach ich darüber.«
Grete Bloch hatte sich über Kafka schon des Öfteren mündlich geäußert, eine »fabelhafte Persönlichkeit« sei das gewesen, doch niemals zuvor hatte sie eine derartige Nähe angedeutet. Dennoch schienen Schocken die Charakteristika, die sie anführte, eindeutig auf Kafka zu verweisen. Diese Vermutung, die sich, wie der Tenor seines Berichts zeigt, allmählich zu einer Autosuggestion auswuchs, behielt Schocken acht Jahre lang für sich. Dann teilte er den Inhalt des Briefes Max Brod mit, gegen das Versprechen, ihn nicht an die Öffentlichkeit zu tragen. [470]
Brod hat diese Zusage nicht nur gebrochen, er hat Schockens Vermutung zu seiner eigenen gemacht und als unzweifelhaftes Faktum verkündet. Zu denken gab ihm weder die Tatsache, dass Grete Bloch den Namen Kafkas nicht nennt (was sie doch gerade gegenüber Schocken hätte tun können), noch ihr Hinweis, der Geliebte sei »in seiner Heimat« gestorben (was auf Kafka nicht zutrifft). Ja, genau besehen war hier nicht einmal von einem Schriftsteller die Rede, sondern von einem Meister irgendeines Fachs. Nun muss freilich für Brod die Versuchung besonders stark gewesen sein, nachträglich Licht in eine Affäre zu bringen, die Kafka vor ihm weitgehend verborgen hatte – nicht Brod, sondern Ernst Weiß war ja in den entscheidenden Monaten Kafkas Vertrauter gewesen, Weiß war es, der über das Dreieck Franz–Felice–Grete stets auf dem Laufenden war und auch mehrfach versuchte, auf Kafkas Heiratspläne Einfluss zu nehmen. Brod wusste wenig darüber, und da im Jahr 1948 weder Kafkas Briefe an Grete Bloch noch die an Felice Bauer zugänglich waren, hatte Brod auch keinerlei Möglichkeit, seine Version der Geschichte zu überprüfen. Dass er auch dann noch daran festhielt, nachdem er diese Briefe gelesen hatte, {497} ist freilich kaum mehr nachzuvollziehen – es ist das vielleicht eklatanteste Beispiel für Brods notorisch gedankenlosen Umgang mit Erinnerungen und Quellen. [471]
Was sind die Fakten? Tatsächlich war Grete Bloch Mutter eines Kindes: Ein Foto blieb erhalten, auf dem sie mit dem Jungen zu sehen ist. Legt man ihre Angaben zugrunde, so wurde dieses Kind in den Jahren 1914 oder 1915 geboren. Der einzige Hinweis auf eine derartige Zäsur findet sich in Kafkas Briefen jedoch erst im folgenden Jahr: »Wie trägt es Frl. Bloch und was bedeutet es für sie?«, fragt er Felice Bauer, und am folgenden Tag fährt er fort: »Fräulein Gretes Leid geht mir sehr zu Herzen; jetzt verlässt Du sie gewiss nicht, wie Du es früher manchmal […] scheinbar unbegreiflich getan hast.« [472] Deutlicher konnte Kafka jenes »Leid« nicht beim Namen nennen, denn wegen der Kriegszensur benutzte er offene Postkarten. Der dringliche Ton lässt jedoch kaum Zweifel daran, dass es sich um ein existenziell bedeutsames Ereignis gehandelt haben muss: eine Geburt, eine Fehlgeburt, die Feststellung einer unehelichen Schwangerschaft, möglicherweise aber auch das Verlassenwerden durch den Vater des bereits lebenden Sohnes. Wir wissen es nicht. Weder Kafkas Tagebücher noch seine Briefe geben den schwächsten Hinweis darauf, dass er – nach der ersten Begegnung – mit Grete Bloch jemals wieder allein zusammengetroffen wäre. Hätte er aber tatsächlich damit rechnen müssen, selbst der Urheber des Unglücks zu sein, so wäre es nicht sonderlich klug gewesen, derart scheinheilige Fragen zu stellen – zu schweigen davon, dass sie zu Kafkas sonstiger Skrupelhaftigkeit in unüberbrückbarem Widerspruch stünden.
Wer aber war der Vater des Kindes? Auch dazu gibt es kaum mehr als verwischte Spuren. Zu der Zeit, da sie Kafka kennen lernte, war Grete Bloch in eine schwierige Liaison mit einem »Mann aus München« verwickelt, eine Beziehung, an der noch eine weitere Frau beteiligt war. Offenbar versuchte Bloch, sich zu lösen, denn sie bat Kafka darum, einen Brief an ihren Liebhaber zur Post zu geben – wohl um zu vermeiden, dass ein Wiener Poststempel darauf erschien. Kafka wiederum wusste, was er tat, denn er äußerte »Bedenken« gegenüber dieser List und empfahl stattdessen eine Aussprache. [473] Dass auch hier wiederum die Stadt München im Spiel ist, zu der Grete Bloch sonst keinerlei erkennbare Verbindung
Weitere Kostenlose Bücher