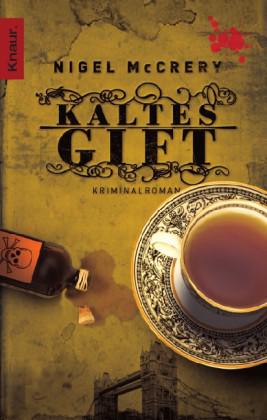![Kaltes Gift]()
Kaltes Gift
Doppeltür an einer
Seite der Halle gegangen war, befand er sich alsbald in einem typischen
Krankenhaus: Ein Labyrinth aus rechtwinkligen Korridoren, die nach
Desinfektionsmittel rochen, Wände und Linoleum im Laufe der Jahrzehnte
von rollendem Krankenhausgerät zerschrammt. Das ursprüngliche Gebäude
aus den fünfziger Jahren war lediglich genauso hinter einer
eindrucksvollen neuen Fassade versteckt worden, wie die Damen zu
Baudelaires Zeiten ihre pockennarbigen Gesichter unter dicken
Schminkschichten verborgen hatten.
Eine Handvoll Menschen saßen im Wartebereich der
neurologischen Ambulanz.
Lapslie setzte sich, wartete mit ihnen auf seinen Termin und
gab sich alle Mühe, keinerlei Mutmaßungen über sie anzustellen.
Schließlich war er nicht im Dienst.
Er hatte seine Ankunft zeitlich perfekt abgestimmt, denn
innerhalb von fünf Minuten wurde sein Name aufgerufen. Das Sprechzimmer
war klein, anonym, mit weißen Wänden, einem Rollwagen, einem
Schreibtisch mit Computer darauf und ein paar Stühlen. Es hätte jedes
Sprechzimmer in jedem Krankenhaus oder Spital sein können, überall im
Land.
Der junge Mann, der am Schreibtisch saß, war Lapslie
unbekannt. Er las Informationen auf seinem Bildschirm, als Lapslie
eintrat, und streckte die Hand aus, ohne den Blick vom Computer zu
wenden. »Hallo. Ich bin Dr. Considine. Ich glaube, ich habe Sie noch
nicht untersucht, oder?«
»Mark Lapslie.« Er schüttelte die Hand des Arztes und setzte
sich. »Ich bin seit etwa zehn Jahren immer bei Dr. Lombardy gewesen.«
»Dr. Lombardy hat sich vor etwa sechs Monaten zur Ruhe
gesetzt. Ein sehr gescheiter Mann. Ein großer Verlust für das
Krankenhaus.« Wieder konsultierte er den Computer. »Ich sehe, Sie sind
Synästhesiepatient. Wir bekommen hier nicht viele solche Patienten zu
sehen – die Häufigkeitsschätzungen schwanken zwischen sechs
Menschen pro eine Million und drei von hundert, je nachdem, wie weit
man die Grenzen der Symptomatik ausweiten will. Sie gehören anscheinend
zu der kleinen Patientengruppe, bei der die Symptome so ausgeprägt
sind, dass sie im Alltagsleben Probleme machen. Wann waren Sie zum
letzten Mal hier?«
»Vor einem Jahr.«
»Und hat sich Ihr Zustand in der Zeit verändert – ist
er schlimmer oder besser geworden?«
»Er ist unverändert.«
»Hmm.« Der Arzt klopfte mit den Fingern auf den Schreibtisch.
»Dr. Lombardy hat Ihnen bestimmt gesagt, dass es für Synästhesie keine
Behandlung und keine Heilung gibt? Das ist etwas, womit Sie leben
müssen.«
Lapslie nickte. »Das hat er mir gesagt. Wir haben aber
abgesprochen, dass ich trotzdem so etwa einmal im Jahr wiederkommen
soll, um zu erfahren, ob es in der Forschung irgendwelche größeren
Fortschritte gibt.«
Dr. Considine schüttelte den Kopf. »Nicht dass ich wüsste. Das
ist immer noch weitgehend ein Rätsel. Wir wissen durch die
Kernspintomographie des Gehirns zum Beispiel, dass Synästhesiepatienten
wie Sie andere Muster der Hirnaktivität zeigen als normale
Menschen – in Ermangelung eines besseren Wortes –,
aber wir versuchen immer noch, herauszufinden, was der Unterschied
bedeutet. Es ist immer noch ein Rätsel.«
»Eins, das meine Karriere und mein Privatleben
beeinträchtigt«, antwortete Lapslie bitter. »Es ist einfach, zu sagen,
es gibt keine Therapie, aber Sie müssen ja auch nicht damit leben.
Meine Karriere ist zum Stillstand gekommen, weil ich nicht unter
Menschen gehen kann, wie es die anderen tun. Ich habe mich von meiner
Familie getrennt, weil ich den ständigen Geschmack im Mund nicht
ertrage, wenn sie um mich ist. Ich kann nicht fernsehen oder ins Kino
oder ins Konzert gehen, aus Angst, dass ich mich plötzlich übergeben
muss. Labbriges Eigelb und kreidige Tabletten gegen Sodbrennen sind
schon schlimm genug, aber ein plötzlicher Schwall von stinkendem
Abwasser oder Erbrochenem in der Kehle, das kann einem schon den ganzen
Abend verderben.«
»Ich verstehe.« Der Arzt machte sich ein paar Notizen auf
einem Block, der vor ihm lag. »Und verzeihen Sie mir die Frage, aber
gibt es da vielleicht auch eine Kehrseite der Medaille? Bringt die
Synästhesie Ihnen auch Vorteile?«
»Ich hab ein sehr gutes Personengedächtnis – ich habe
den Verdacht, das kommt, weil ich ihre Stimmen jeweils mit einem
bestimmten Geschmack assoziiere.«
»Das wundert mich jetzt aber – hat meine Stimme auch
einen Geschmack?«
Lapslie lachte. »Sie wären überrascht, wie viele Leute mich
das fragen, wenn sie von meinem Problem
Weitere Kostenlose Bücher