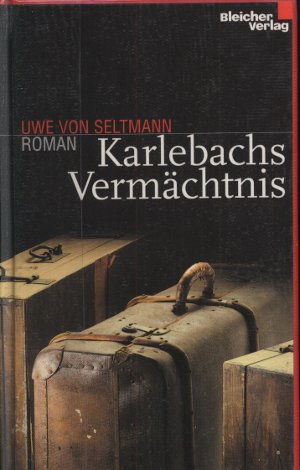![Karlebachs Vermaechtnis]()
Karlebachs Vermaechtnis
schwärmte ohne Unterlass in einem Gemisch aus Arabisch, Englisch und Deutsch von der Schönheit seines Landes und bot mir an, mich einmal einen ganzen Tag lang herumzufahren und mir seine Heimat zu zeigen.
Der Taxifahrer, der mich ins Wartezimmer begleitete, wurde von allen Seiten freundlich begrüßt. Er führte mich zu einer jungen Frau, der Sprechstundengehilfin, wie ich annahm. Ihre Schönheit überwältigte mich. Simona Zorbas, die nun wahrlich nicht hässlich war, würde neben ihr wie ein Mauerblümchen verblassen. Ihre mit Cayalstift schwarzumrandeten tiefbraunen Augen, ihre ebenmäßigen Gesichtszüge, ihre langen, mit einem grünen Haarband gebändigten Locken zogen meinen Blick magisch an. Meine Trauerzeit um die zerbrochene Beziehung zu Simona hatte von einer Sekunde auf die andere ihr Ende gefunden. Ich war bereit zu neuen Taten und hatte Mühe, mich bei der Angabe meiner Personalien zu konzentrieren. Ich verhaspelte mich so oft, dass die Schönheit mir schließlich das Formular vorlegte, damit ich es selber ausfülle. Ich konnte die arabischen Schriftzeichen nicht entziffern, fand aber keinen Mut, sie um Hilfe zu bitten. Schließlich zog ich Yassir beiseite. Als ich ihr das ausgefüllte Formular überreichte, sagte mir die schöne Frau, dass es noch ein wenig dauern werde. Ich setzte mich in eine Ecke und beobachtete drei kleine Jungen, die in dem überfüflten Wartezimmer Fangen spielten. Niemand ließ sich durch die Unruhe stören. Hin und wieder betrachtete ich verstohlen die Schönheit, die jedes Mal, wenn sich unsere Blicke kreuzten, ihre Augen rasch senkte. Yassir war mit zwei Männern in ein Gespräch vertieft, in das sich nach und nach das gesamte Wartezimmer einschaltete. Ich bedauerte, nichts von dem Palaver zu verstehen. Etwa eine Viertelstunde später betrat Doktor Naseer den Raum. Er war ein kleiner rundlicher Mann mit Glatze, etwa um die vierzig. Ein weißer Kittel, aus dessen Seitentasche ein Hörrohr baumelte, wölbte sich um seinen Bauch. Unter seiner mächtigen Nase wuchs ein noch mächtigerer Schnurrbart, der ihm das Aussehen eines gutmütigen Seehundes verlieh. Er begleitete eine alte Frau, die sich auf einen Stock stützte, zur Tür und rief Yassir, dass er sie nach Hause bringen solle. Nach einem kurzen Gespräch mit der Schönheit begrüßte er mich mit einem nahezu akzentfreien Deutsch.
»Herzlich willkommen in meiner Praxis«, sagte er. »Was führt sie zu mir?«
Er leitete mich in ein kleines Behandlungszimmer. Ich wollte gerade meinen Schuh ausziehen, um ihm die Wunde zu zeigen, da sagte er, dass wir erst einmal einen Kaffee trinken sollten. »Ich freue mich, wenn ich noch einmal Deutsch sprechen kann«, meinte er. »Ich habe in Deutschland studiert. Zwei Jahre in Tübingen und zwei in Marburg. Und dann noch zwei in Oxford.«
»Und dann sind sie wieder zurück nach Palästina?«
»Es hört sich vielleicht etwas pathetisch an«, erzählte er, nachdem er sich eine Zigarette angezündet hatte, »aber ich wollte meinem Volk dienen. Ich liebe mein Land. Da war es für mich keine Frage, dass ich wieder zurückkomme. Mein Bruder lebt in Amerika und arbeitet als Jurist in der Anwaltspraxis meines Onkels. Sie sind beide sehr vermögend und unterstützen mich und unsere Familie generös. Oft haben sie gesagt, ich solle in den USA eine Praxis aufmachen, aber ich konnte es nicht tun.«
»Respekt«, äußerte ich anerkennend. »Nein«, entgegnete er. »Jeder Mensch muss das tun, wofür ihn Gott bestimmt hat. Und mein Platz ist in Palästina, bei meinem Volk.«
»Sind Sie Christ oder Moslem?«
»Ich bin Christ. Mein jüngster Bruder ist Pfarrer. Aber was spielt das für eine Rolle? Ich versuche mit allen in Frieden zu leben, mit den Moslems und mit den Juden.« Es klopfte an die Tür und die Schönheit winkte Doktor Naseer hastig zu sich.
»Sie entschuldigen mich bitte«, sagte er zu mir, »ein Notfall. Ein Mann ist von einem Soldaten angeschossen worden. Meine Assistentin, Frau Fatma Franghi, wird sich Ihren Fuß anschauen.«
Niemals in meinem Leben hatte ich mich lieber behandeln lassen. Die Spritze, die Fatma Franghi in meinen Hintern jagte, ertrug ich mit Gelassenheit, die Schmerzen beim Desinfizieren der Wunde nahm ich gerne auf mich. Erst als sie sagte, dass ich meinen Fuß schonen müsse und drei Tage nicht laufen dürfe, begehrte ich auf. Ich müsse in nächster Zeit sehr viel erledigen, versuchte ich zu erklären. »Nein«, sagte sie plötzlich auf Deutsch, »Sie müssen
Weitere Kostenlose Bücher