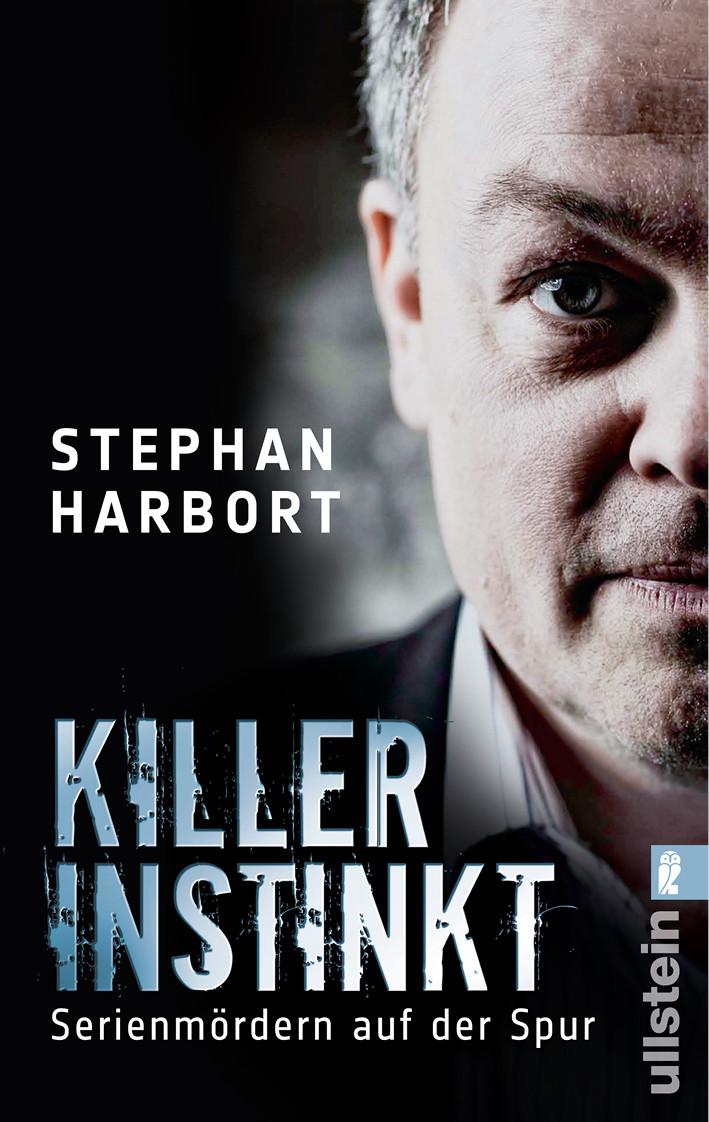![Killerinstinkt: Serienmördern auf der Spur (German Edition)]()
Killerinstinkt: Serienmördern auf der Spur (German Edition)
in diesem Punkt nicht weiter, obwohl sein Bemühen um Aufklärung aufrichtig war.
Im Dezember 2011 starte ich einen erneuten Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe mir für dieses Gespräch eine andere Strategie überlegt, wie ich Thomas Bracht dabei behilflich sein könnte, sich und seine Taten besser zu verstehen, das Motiv endlich freizulegen.
Die vorherigen Interviews haben an neutralen Orten stattgefunden, diesmal hat Thomas Bracht mich zu sich nach Hause eingeladen. Seine Drei-Zimmer-Wohnung im Parterre eines gepflegten Mehrfamilienhauses ist vollgestopft mit Grünpflanzen, an den Wänden hängen großformatige Bilder und zeigen imposante Landschaften und Tieraufnahmen. Die Fotos habe er bei Urlauben in Neuseeland, Südafrika und Thailand selbst geschossen, erzählt er mir stolz. Ich bin beeindruckt.
Nach der Begrüßung gehen wir in sein Wohnzimmer, der Hausherr serviert Kaffee und Kuchen. Vor mir sitzt ein asketisch wirkender 56-Jähriger, der sein kantiges, von Falten zerfurchtes Gesicht hinter einem Vollbart zu verstecken scheint und freundlich lächelt. Eine Nickelbrille umrahmt seine dunklen Augen, die Hände sind gepflegt, der Mann könnte auch als Intellektueller durchgehen. Thomas Bracht hat nichts Anstößiges oder Abstoßendes an sich.
Weil ich bei meinen bisherigen Analysen zu dem Ergebnis gelangt bin, die Beweggründe für seine Taten dürften insbesondere aus den Lebensumständen abzuleiten sein, die ihn schon Monate vor der ersten Tötung bewegt haben, bitte ich ihn, mir von dieser Zeit zu berichten. Nachdem ich meine Frage gestellt habe, drücke ich die Aufnahmetaste meines Diktaphons. »Das war eine sehr belastende Situation«, beginnt Thomas Bracht zu erzählen. »Ich wollte eigentlich immer Kinder haben mit meiner Frau, es hat aber nicht geklappt. Aus diesem Grund bin ich zum Arzt gegangen und hab mich untersuchen lassen. Der hat dann festgestellt, dass ich zu wenige und zu unbewegliche Samenfäden habe. Und damit war für mich das Kinderzeugen im Prinzip gestorben. Er hat mir zwar gesagt, es gäbe da wohl Medikamente, da könnte man vielleicht etwas erreichen, aber das habe ich ihm nicht geglaubt.«
Thomas Bracht macht eine kurze Pause. Dieses erste sehr intime Bekenntnis bestärkt mich in der Annahme, im Verlauf der letzten Jahre zu ihm ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zu haben. Wir duzen uns mittlerweile. Für mich ist das nicht ungewöhnlich. Im Gegenteil: Ich habe festgestellt, dass sich das Duzen fast von allein aus dem Vertrauensverhältnis ergibt, ohne das ich in meinen Gesprächen nur schwer in tiefere, oft unbewusste Regionen bei den Tätern vordringen kann. Oder anders ausgedrückt: Ohne Vertrauen in mich und meine Art, mit seinen Antworten umzugehen, wird sich kein Täter und auch kein Angehöriger eines Mordopfers meinen Fragen öffnen. Das gegenseitige Du ist dabei eine gute, stabile Brücke.
»Danach bin ich in ein ziemlich tiefes Loch gefallen«, fährt er fort. »Meine ganze Zukunftsplanung war dahin. Dabei hatte ich schon damit begonnen, unser Haus umzubauen. Ich wollte den Dachboden ausbauen und dort die Kinderzimmer einrichten. Plötzlich tat sich ein tiefes schwarzes Loch auf. Ich habe das auch meiner Familie erzählt, aber da hieß es nur lapidar: ›Adoptiert doch einfach eins.‹ Das war aber nicht so einfach, und ich wollte unbedingt eigene Kinder haben.«
»Hast du deine Zeugungsunfähigkeit als Kränkung empfunden? Oder eher als Schicksalsschlag?«
»Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich damals empfunden habe. Einfach nur diese Aussichtslosigkeit. Ich hatte keine Zukunft mehr.«
»Die Hoffnung auf ein Leben, wie du es dir vorgestellt hattest, musstest du aufgeben. Das ist ein schwerer Schlag, ich habe selbst Ähnliches erlebt. Und wie kamst du jetzt an deinem Arbeitsplatz und mit deinen Kollegen zurecht?«
»Der Charakter der Station hatte sich schon ein paar Wochen oder Monate vorher verändert. Zuvor war es eine psychosomatische Station, auf der auch mal internistische Patienten und auch Suchtkranke behandelt wurden. Aber dann wurde es immer mehr zu einer Sterbestation. Die Risikopatienten wurden von der Psychiatrie auf unsere Station verlegt, weil es dort keine Todesfälle geben sollte. Das passierte meistens freitags. Deshalb hieß das bei uns Morbus Freitag. Und die Patienten waren dann montags oder Tage später tot. Im Grunde wurden Sterbende zu uns verlegt.«
»Also hast du damals in so einer Art Hospiz im Krankenhaus
Weitere Kostenlose Bücher