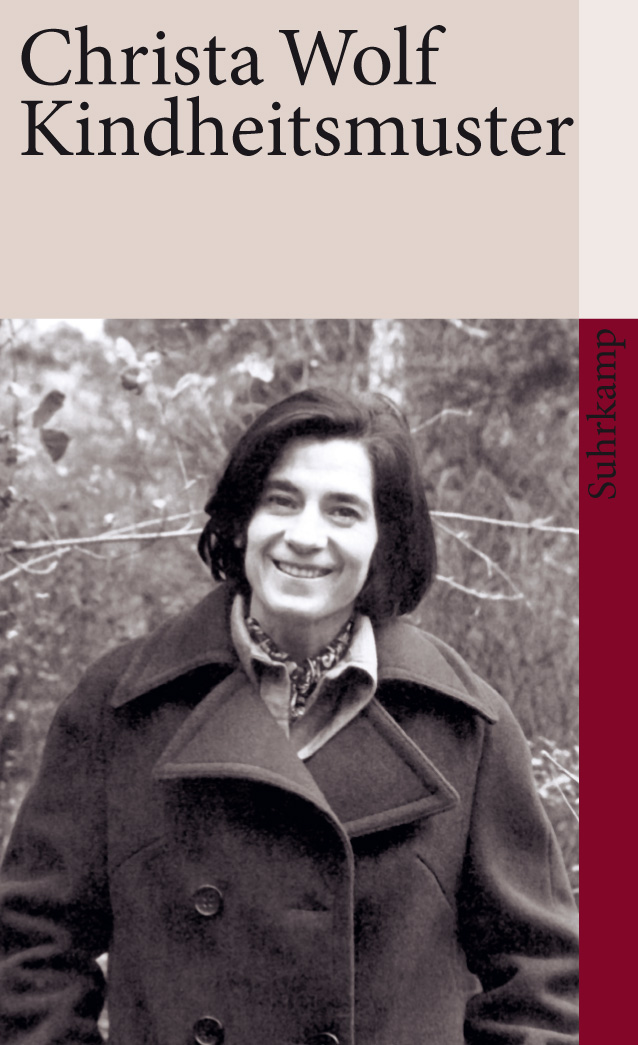![Kindheitsmuster]()
Kindheitsmuster
einem Ferientag, heiß wahrscheinlich – mag Nelly, wie sie es liebte, in ihrer Kartoffelfurche im Garten gelegen haben, unter den Schattenmorellen, lesend, während eine Eidechse sich auf ihrem Bauch sonnte. Vielleicht sprang sie dann auf, als aus dem Radio, das sommers in der Veranda stand, nach der Fanfare für die Sondermeldungen vom weiteren Vormarsch der deutschen Truppen in Rußland die Rede war. Ihr Vater war nicht mehr dabei. Sein Jahrgang wurde nach dem Polenfeldzug demobilisiert, er selber, »garnisonsdienstverwendungsfähig Heimat«, als Unteroffizier in der Schreibstube des Wehrbezirkskommandos in L. eingesetzt.
So oder wenig anders verging ihr der Tag, an dem der Reichsmarschall Hermann Göring den Chef der Sicherheitspolizeiund Leiter des Sicherheitsdienstes (SD) Reinhard Heydrich im Auftrag des Führers mit der »Endlösung der Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in Europa« betraute: denselben Heydrich, an den am 24. Januar 1939 – Nelly ist keine zehn Jahre alt – der Befehl zur Vollstreckung der Endlösung im deutschen Reichsgebiet ergangen war.
Beide Daten – das eine jährte sich dieses Jahr, 1974, zum fünfunddreißigstenmal – hätten, eher als manche andere, ihren Gedenktag verdient. Dieser Eichmann, fragte Lenka neulich, wer ist denn das eigentlich. Ihr verstummtet. Dann verlangtest du, ihr Geschichtsbuch zu sehen. Neunte Klasse, sagte sie und suchte es unlustig unter den abgelegten Schulbüchern in einem Karton im Keller.
Der faschistischen Diktatur in Deutschland sind fast hundert Seiten gewidmet. Der Name Adolf Eichmann, davon überzeugtest du dich, wird nicht genannt. Zweimal wird Heinrich Himmler erwähnt, davon einmal mit dem Ausspruch: »Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur soweit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiert mich das nicht.«
Posen – heute Poznań –, wo diese Rede am 4. Oktober 1943 vor SS-Gruppenführern gehalten wurde, lag lausige hundertdreißig Kilometer von Nellys Heimatstadt entfernt. So weit nach Osten ist sie als Kind nicht gekommen. Du gibst Lenka aus der gleichen Rede ein paar Sätze mehr: »Es ist grundfalsch, wenn wir unsere ganze harmlose Seele mit Gemüt, wenn wir unsere Gutmütigkeit, unseren Liberalismus in fremde Völker hineintragen.« Lenka sieht dir über die Schulter, gemeinsamlest ihr, was man nicht vorlesen kann: »Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn hundert Leichen beisammenliegen, wenn fünfhundert daliegen oder wenn tausend daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt in unserer Geschichte ...«
Lenka schweigt.
In ihrem Geschichtsbuch ist auf der Seite 206 das Lagertor von Auschwitz-Birkenau abgebildet (Lenkas Assoziation ist: Franci. Franci aus Prag, die sie seit ihrer frühen Kindheit liebt, ist durch dieses Tor gegangen). Darunter stehen vier Zitate aus einem Briefwechsel zwischen der I. G. Farben und dem Konzentrationslager Auschwitz betreffs einer Lieferung von Frauen aus dem KZ an das Werk zu Versuchszwecken, für die ein Stückpreis von 170 Mark festgesetzt wird; 150 Frauen sterben an den Versuchen, wird präzis mitgeteilt. »Wir werden Sie in Kürze betreffend einer neuen Lieferung benachrichtigen.« Lenka hat keine Assoziation.
Was ist ihr I. G. Farben?
Dir ist I. G. Farben der ausgedehnte Gebäudekomplex aus roten Backsteinen, der Mitte der dreißiger Jahre rechter Hand von der Friedeberger Chaussee gebaut wurde, ein weitläufiges Gelände mit Produktionsstätten, in denen die letzten Arbeitslosen der Stadt Arbeit und Brot fanden (Stellungsangebote im »General-Anzeiger«!). Im Krieg standen auf dem Gelände auch die Wohnbaracken der Wolga- und Wolhyniendeutschen, die der Führer heim ins Reich geholt hatte, damit siebei I. G. Farben arbeiten und zu Weihnachten von den Jungmädeln – Nelly unter ihnen – mit selbstgestrickten Schals und Fausthandschuhen und selbstgebackenen Pfefferkuchen beschenkt werden konnten. Die wolhyniendeutschen Frauen weinten, wenn die Jungmädel »Heitschibumbeitschi« sangen, sie wischten sich die Augen mit den Zipfeln ihrer schwarzen Kopftücher, die sie auch in der Stube umbehielten (aber was heißt hier Stube: Es waren Barackenräume mit rohen Holztischen und Doppelstockbetten, in
Weitere Kostenlose Bücher