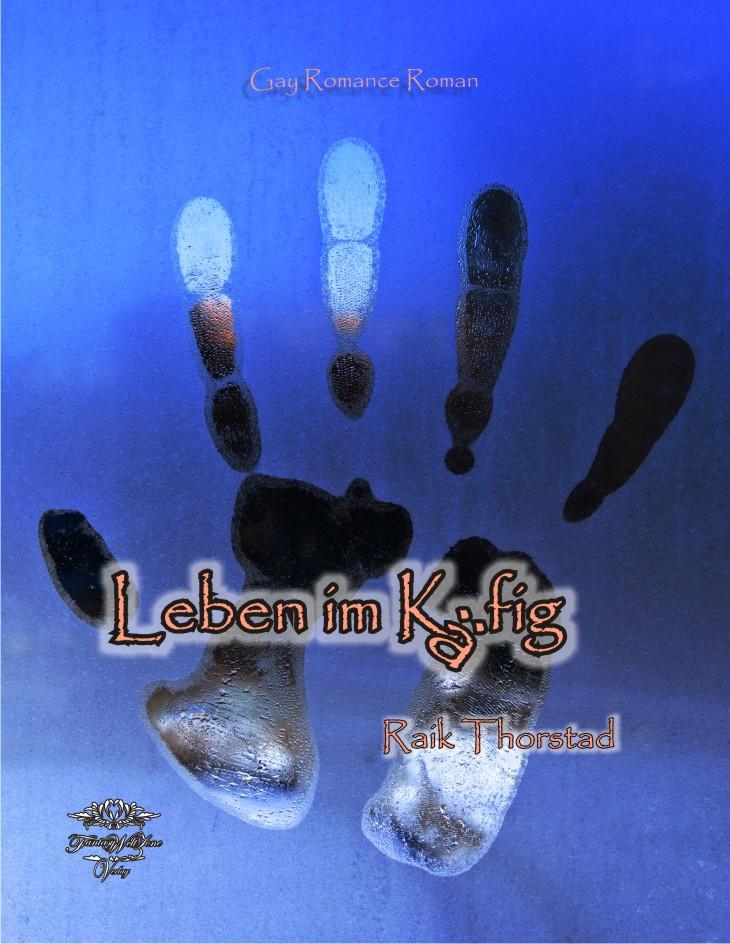![Leben im Käfig (German Edition)]()
Leben im Käfig (German Edition)
aus“, lächelte eine geschäftige Blondine mitleidig mit Blick auf Andreas' schmerzverzerrtes Gesicht. „Waren Sie schon einmal bei uns?“
Er schüttelte den Kopf, bevor er schwach sagte: „Es ... hat jemand angerufen ... mich angemeldet. Ich. Ich ... habe Probleme mit ...“
„Angst? Ja, ich erinnere mich an den Anruf. Das schaffen wir schon“, wollte sie ihn aufmuntern und reichte ihm ein Klemmbrett mit einem Blatt Papier: „Sie sind privat versichert, nicht wahr? Sind Sie so nett und füllen uns das hier aus?“ Sie prüfte ihre Notizen, bevor sie mitfühlend sagte: „Herr von Winterfeld, es wird sich leider etwas verzögern. Sie kommen direkt nach dem nächsten Patienten dran, aber ein wenig müssen Sie noch warten.“
„Sorgen Sie dafür, dass er nicht stiften geht“, schaltete der Taxifahrer sich ein. An Andreas gewandt fügte er hinzu: „Und du packst das schon, Junge. Soll ich eine Rechnung schicken oder ...“
Andreas schüttelte den Kopf, zahlte nervös den angefallenen Betrag und sah sich dabei heimlich nach dem Ausgang um. Dass der Fahrer sich verabschiedete, registrierte er kaum. Warten? Er sollte warten? Oh nein, das konnte er nicht ertragen. Weder seine Schmerzen noch seine immer stärker werdende Angst ließen das zu. Er wollte verschwinden. Jetzt. Gleich. Sofort.
„Nehmen Sie bitte noch einen Moment Platz.“
Die Arzthelferin deutete auf einen Wartebereich, indem ein halbes Dutzend anderer Patienten mit leidender Miene auf ihre Behandlung wartete. Automatisch ging Andreas rückwärts. Das konnte er nicht. Das war zu viel verlangt. Lauter fremde Menschen? Die alle Schmerzen hatten und ihn permanent daran erinnerten, was ihm bevorstand? Nein, keine Chance.
Langsam setzte er einen Fuß nach dem anderen nach hinten. Etwas klapperte.
„Herr von Winterfeld?“, schaltete die Klinikangestellte sich wieder ein. Sie musterte ihn prüfend, aber keinesfalls abwertend. „Stimmt etwas nicht? Wird Ihnen übel?“
Sie stand auf und umrundete ihren Arbeitsplatz, kam ihm entgegen. Schnell hob sie das zu Boden gegangene Klemmbrett wieder auf.
„Ich kann ... kann ... da nicht hin ... ich ... habe Panik ... wenn Menschen ...“
„In Ordnung. Versuchen Sie sich zu beruhigen. Wir lösen das anders.“
Sie sah sich eilig um, winkte einem Kollegen und bat ihn, auf ihren Platz aufzupassen. Anschließend fasste sie Andreas stützend am Arm – er war ihr dankbar – und führte ihn tiefer in die Katakomben des Kellers hinein.
Sie klopfte an einer unbeschrifteten Tür, steckte den Kopf hinein und sagte schließlich: „Hier ist frei. Legen Sie sich hin, wenn Sie möchten. Trinken Sie einen Schluck. Wir tun alles, damit Sie es bald geschafft haben.“
Der Raum war schmal, enthielt kaum mehr als eine Liege, ein kleines Waschbecken und ein ihm unbekanntes medizinisches Gerät, das aussah, als hätte es seine besten Jahre hinter sich. Waschbecken. Das war gut. Waschbecken bedeutete etwas zu trinken, sich übergeben können und seinen Kreislauf stabil halten, indem er sich das Wasser über die Arme laufen ließ. Und er war allein. Mit seinen Schmerzen, aber immerhin allein.
Mit angezogenen Beinen hockte Andreas sich auf die Liege. Den Kopf lehnte er an die Wand, während er versuchte, die fremde Umgebung auszublenden. Wie lange war es her, dass er sich in einem fremden Gebäude aufgehalten hatte? Ewig. Und er wusste, dass der einzige Grund, warum er nicht den Verstand verlor und rannte, die Tatsache war, dass er nicht mehr konnte. Seine Kräfte waren erschöpft.
Die Viertelstunde, die er warten musste, wurde trotz Ausfüllens des Patientenblatts zur Ewigkeit. Zwischen Müdigkeit, Angst und Qualen gefangen kauerte er sich eng an die Wand. Ein paar stumme Tränen flossen, während er sich verzweifelt danach sehnte, jemanden an seiner Seite zu haben. Jemanden, der zum Empfang ging und fragte, was verdammt noch mal so lange dauerte.
Als es endlich so weit war, noch vor der Behandlung, schwor Andreas sich, nie wieder freiwillig das Haus zu verlassen oder zu einem Zahnarzt zu gehen. Das nächste Mal würde er sich eher mit der Zange begnügen, als von anderen Menschen abhängig zu sein.
Sie brachten ihn in einen hell erleuchteten Raum. Das grelle Licht tat seinen müden Augen weh und verstärkte seine Kopfschmerzen. Martialisch wirkende Gerätschaften lauerten auf ihn, aber auch eine Schublade voller Spritzen und Betäubungsmittel.
Man bat ihn, Platz zu nehmen. Eine souverän wirkende Ärztin
Weitere Kostenlose Bücher